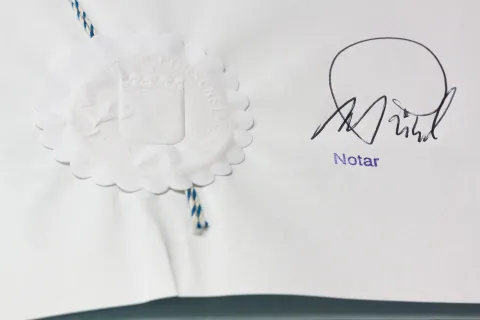Das Aufrechnungsverbot des § 394 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 850 Abs. 1 und 2, § 850c Abs. 1 ZPO kann auch dann bestehen, wenn die vergüteten Dienstleistungen (§ 850 Abs. 2 ZPO) von einem freiberuflich Tätigen erbracht werden1.

In dem hier vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall nimmt der klagende Auftragnehmer seine Auftraggeberin auf Zahlung einer vertraglich vereinbarten Vergütung in Anspruch. Die Parteien unterzeichneten am 22.07.2010 einen als „Vorvertrag“ bezeichneten Vertrag, nach welchem der Auftragnehmer die Auftraggeberin dabei unterstützen sollte, den Forderungsbestand der P. GmbH & Co. KG (Insolvenzschuldnerin) einzuziehen, welchen die Auftraggeberin von deren Insolvenzverwalter erwerben wollte. Der Auftragnehmer sollte freiberuflich tätig werden. Eine feste Arbeitszeit wurde nicht vereinbart. Ihm sollte ein Büro nebst Lagerfläche für die Akten zur Verfügung stehen. Die Auftraggeberin verpflichtete sich, dem Auftragnehmer monatlich pauschal 1.000 € zu zahlen. Darüber hinaus sollte er nach Beendigung seiner Aufgabe beziehungsweise nach Ablauf des Vertrags eine erfolgsabhängige Prämie erhalten.
Nach Erwerb der Forderungen wurde von der Auftraggeberin eine Wohnung angemietet, in welcher der Auftragnehmer die nach dem (Vor-)Vertrag geschuldete Tätigkeit ausübte und Akten lagerte. Die Auftraggeberin zahlte dem Auftragnehmer bis zum 31.01.2019 monatlich 1.000 €. Zum 1.02.2019 stellte sie die monatlichen Zahlungen ein und kündigte mit Schreiben vom 27.08.2020 den (Vor-)Vertrag zum 30.11.2020. Ebenso wurde der die vorgenannte Wohnung betreffenden Mietvertrag gekündigt. Der Auftragnehmer räumte die ihm überlassenen Räume nicht, sondern nutzte sie jedenfalls bis zum 12.06.2023 weiter.
Mit der Klage begehrt der Auftragnehmer die Zahlung der monatlichen Vergütung von 1.000 € für die Monate Februar 2019 bis einschließlich November 2020 – insgesamt 22.000 € – nebst Zinsen. Die Auftraggeberin hat hilfsweise die Aufrechnung mit Forderungen erklärt, die ihre Grundlage in den Mietzahlungen der vom Auftragnehmer weitergenutzten Räume haben.
Das erstinstanzlich hiermit befasste Landgericht Verden hat die Klage abgewiesen2. Das Oberlandesgericht Celle hat die hiergegen eingelegte Berufung des Auftragnehmers zurückgewiesen3. Auf die Revision des Auftragnehmers hat auch der Bundesgerichtshof die Aufrechnung der Auftraggeberin zwar als zulässig angesehen, das Berufungsurteil aber im Hinblick auf das Aufrechnungsverbots aus § 394 Satz 1 BGB in Verbindung mit den §§ 850 ff ZPO aufgehoben und zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Oberlandesgericht Celle zurückverwiesen:
Das Oberlandesgericht Celle hat zutreffend und von der Auftraggeberin nicht angegriffen angenommen, dass diese dem Auftragnehmer gemäß § 611 Abs. 1 BGB in Verbindung mit § 2 Abs. 1 des (Vor-)Vertrags vom 22.07.2010 die darin vereinbarte Pauschalvergütung für die Monate Februar 2019 bis November 2020 – insgesamt 22.000 € – schuldet und die monatlichen Teilbeträge von 1.000 € jeweils seit dem Ersten des Folgemonats nach § 286 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1, § 288 Abs. 1 BGB mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen hat.
Das Oberlandesgericht Celle hat des Weiteren richtig gesehen, dass der Auftragnehmer die ihm von der Auftraggeberin zur Durchführung des (Vor-)Vertrags nach dessen § 2 Abs. 3 zur Verfügung gestellte Bürofläche (Wohnung) nach wirksamer Kündigung des (Vor-)Vertrags zum 30.11.2020 durch die Auftraggeberin vertragswidrig nicht herausgab, sondern jedenfalls bis zum 12.06.2023 weiter nutzte, ihm insoweit weder ein Zurückbehaltungsrecht aus § 273 Abs. 1 BGB4 noch mangels Gegenseitigkeit die Einrede des nicht erfüllten Vertrags aus § 320 Abs. 1 Satz 1 BGB5 zustand und er infolgedessen gemäß § 280 Abs. 1 BGB zum Schadensersatz verpflichtet ist.
Nicht folgen konnte der Bundesgerichtshof dem Oberlandesgericht Celle hingegen insoweit, als es das Eingreifen des Aufrechnungsverbots aus § 394 Satz 1 BGB in Verbindung mit den §§ 850 ff ZPO mit der Begründung verneint hat, der Auftragnehmer habe nach dem Vertrag vom 22.07.2010 eine freiberufliche Tätigkeit erbracht und die dafür gewährte Vergütung stelle kein Arbeitseinkommen im Sinne von § 850c Abs. 1 ZPO dar. Das Oberlandesgericht Celle hat übersehen, dass nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs beim Arbeitseinkommen im Sinne des § 850 Abs.
1 und 2, § 850c Abs. 1 ZPO nicht danach unterschieden wird, ob die vergüteten Dienste in abhängiger oder in freier Stellung geleistet werden6. Die vorgenannten Vorschriften wollen gerade auch freiberuflich Tätige erfassen, sofern sie fortlaufend Vergütungen für persönliche Dienste erhalten, die ihre Erwerbstätigkeit ganz oder zu einem wesentlichen Teil in Anspruch nehmen und deshalb ihre Existenzgrundlage bilden7.
Das angefochtene Urteil konnte daher mit der vom Oberlandesgericht Celle gegebenen Begründung vom Bundesgerichtshof nicht aufrechterhalten werden. Es ist im tenorierten Umfang aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Die Sache ist nicht zur Endentscheidung reif und muss deshalb zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Oberlandesgericht Celle zurückverwiesen werden (§ 563 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 ZPO). Ausgehend davon, dass es sich bei dem geschuldeten Betrag von 1.000 € pro Monat um eine fortlaufend gewährte Vergütung für persönliche Dienste handelte und der Auftragnehmer vorgetragen und unter Beweis gestellt hat, in der Zeit vom 01.10.2010 bis zum 31.01.2019 aufgrund seiner Verpflichtungen aus dem (Vor-)Vertrag vom 22.07.2010 durchgehend jeweils 60 bis 80 Stunden pro Woche für die Auftraggeberin gearbeitet zu haben, wird das Oberlandesgericht Celle für die Beurteilung, ob das Aufrechnungsverbot des § 394 Satz 1 BGB in Verbindung mit den §§ 850 ff. ZPO zum Zuge kommt, die erforderlichen Feststellungen zu treffen haben.
Sollten sich auf der Grundlage der von der Auftraggeberin nach dem insoweit rechtskräftigen Berufungsurteil zu erteilenden Rechnungslegung bis zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Oberlandesgericht Celle noch – unstreitige oder rechtskräftig zuerkannte – Prämienansprüche des Auftragnehmers nach § 2 Abs. 2 des Vertrags vom 22.07.2010 für den hier maßgeblichen Zeitraum Februar 2019 bis November 2020 ergeben, wird zu prüfen sein, ob diese Ansprüche bei der Berechnung des pfändungsfreien Einkommens des Auftragnehmers und damit auch bei der Reichweite eines Aufrechnungsverbots nach § 394 Satz 1 BGB zu berücksichtigen sind. Dagegen kann die Auftraggeberin dem Auftragnehmer Prämienansprüche nicht entgegenhalten, soweit sie diese selbst nicht anerkennt.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 11. September 2025 – III ZR 274/23
- Anschluss an BGH, Urteile vom 08.12.1977 – II ZR 219/75, WM 1978, 109; und vom 05.12.1985 – IX ZR 9/85, BGHZ 96, 324 sowie Beschluss vom 20.05.2015 – VII ZB 50/14, NJW-RR 2015, 1406[↩]
- LG Verden, Teilurteil vom 10.11.2022 – 2 O 6/22[↩]
- OLG Celle, Urteil vom 03.07.2023 – 1 U 96/22[↩]
- vgl. BGH, Urteile vom 02.07.1975 – VIII ZR 87/74, BGHZ 65, 56, 58 f; und vom 22.10.1997 – XII ZR 142/95, NJW-RR 1998, 803, 805[↩]
- vgl. Grüneberg in Grüneberg, BGB, 84. Aufl., § 320 Rn. 4[↩]
- BGH, Urteile vom 08.12.1977 – II ZR 219/75, WM 1978, 109, 114; und vom 05.12.1985 – IX ZR 9/85, BGHZ 96, 324, 327 sowie Beschluss vom 20.05.2015 – VII ZB 50/14, NJW-RR 2015, 1406 Rn. 15[↩]
- vgl. BGH, Urteile vom 08.12.1977; und vom 05.12.1985 sowie Beschluss vom 20.05.2015, jew. aaO[↩]
Bildnachweis:
- Lohn: Peter Stanic | CC0 1.0 Universal