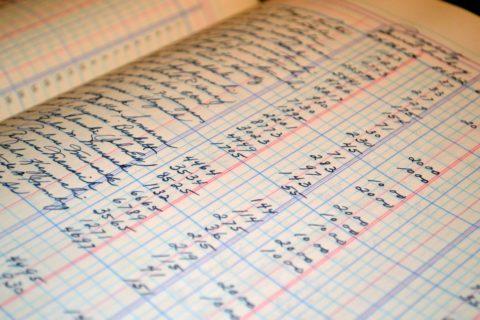Es bestehen für den Bundesfinanzhof keine ernstlichen Zweifel daran, dass die Leistungen eines inländischen Schadensregulierers im Inland steuerbar sind und nicht dem Empfängerortprinzip des § 3a Abs. 4 Nr. 3 UStG unterliegen.

Nach § 3a Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 Nr. 3 UStG in seiner in den Streitjahren geltenden Fassung wurden die sonstigen Leistungen aus der Tätigkeit als Rechtsanwalt, Patentanwalt, Steuerberater, Steuerbevollmächtigter, Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Sachverständiger, Ingenieur, Aufsichtsratsmitglied, Dolmetscher und Übersetzer sowie ähnliche Leistungen anderer Unternehmer, insbesondere die rechtliche, wirtschaftliche und technische Beratung dort ausgeführt, wo der Empfänger sein Unternehmen betreibt. § 3a Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 Nr. 3 UStG ist entsprechend dem ihm unionsrechtlich zugrunde liegenden Art. 9 Abs. 2 Buchst. e dritter Gedankenstrich der Sechsten Richtlinie des Rates vom 17.05.1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern 77/388/EWG (Richtlinie 77/388/EWG) auszulegen1. Danach gilt als Ort der Leistungen von Beratern, Ingenieuren, Studienbüros, Anwälten, Buchprüfern und sonstiger ähnlicher Leistungen sowie der Datenverarbeitung und der Überlassung von Informationen der Ort, an dem der Empfänger den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit hat. Für die Streitjahre 2007 und 2008 folgt dies aus Art. 56 Abs. 1 Buchst. c MwStSystRL2.
Der Bundesfinanzhof braucht im Streitfall nicht zu entscheiden, ob die Anwendung von § 3a Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 Nr. 3 UStG im Streitfall bereits daran scheitert, dass der Verein als „Auftraggeber“ im Inland Empfänger der von der Antragstellerin erbrachten Leistungen war3. Unabhängig hiervon kommt die Anwendung des Empfängerortprinzips nicht in Betracht, da die Antragstellerin keine sonstige Leistung i.S. von § 3a Abs. 4 Nr. 3 UStG erbracht hat.
Der bei richtlinienkonformer Auslegung von § 3a Abs. 4 Nr. 3 UStG zu berücksichtigende Art. 9 Abs. 2 Buchst. e dritter Gedankenstrich der Richtlinie 77/388/EWG bezieht sich nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union nicht auf Berufe, sondern „zieht die in dieser Bestimmung aufgeführten Berufe heran, um die dort angesprochenen Arten von Leistungen zu definieren“4. Dabei muss es sich um Leistungen handeln, die hauptsächlich und gewöhnlich im Rahmen eines dieser Berufe erbracht werden5.
Darüber hinaus bezieht sich der Begriff der sonstigen ähnlichen Leistungen i.S. von Art. 9 Abs. 2 Buchst. e dritter Gedankenstrich der Richtlinie 77/388/EWG nicht auf ein Element, das den in dieser Bestimmung aufgeführten unterschiedlichen Tätigkeiten gemeinsam ist, sondern auf Leistungen, die irgendeiner dieser Tätigkeiten bei gesonderter Betrachtung- ähnlich sind. Dabei ist eine Leistung dann einer in dieser Bestimmung aufgeführten Tätigkeit ähnlich, wenn beide Tätigkeiten dem gleichen Zweck dienen6. Dies ist bei der richtlinienkonformen Auslegung der Tatbestandsmerkmale „rechtliche, wirtschaftlich und technische Beratung gemäß § 3a Abs. 4 Nr. 3 UStG“ zu berücksichtigen.
Danach entsprechen z.B. die Leistungen eines Testamentsvollstreckers nicht denen eines Rechtsanwalts. Denn während die Leistungen des Rechtsanwalts vor allem der Rechtspflege dienen, sind die Leistungen der Testamentsvollstrecker wirtschaftlicher Art und dienen der Bewertung und Verteilung des Vermögens des Erblassers sowie dem Schutz dieses Vermögens und der Fruchtziehung aus diesem7.
Im Streitfall bestehen keine ernstlichen Zweifel daran, dass eine von § 3a Abs. 1 UStG abweichende Leistungsart nach § 3a Abs. 4 Nr. 3 UStG aufgrund einer Ähnlichkeit mit einer Rechtsanwaltsleistung nicht in Betracht kommt. Denn die Rechtsanwaltsleistung wird durch das Handeln zur Rechtspflege geprägt, während die Leistungen der Antragstellerin bei der Schadensregulierung ähnlich einer Testamentsvollstreckung- eher wirtschaftlicher Art sind, dem Vermögensschutz der Versicherung dienen und insoweit Vermögensbetreuungscharakter haben.
Die Gegenauffassung kann sich auch nicht auf eine Parallele zum RDG berufen. Der Bundesfinanzohf hat im Streitfall nicht zu entscheiden, ob die Antragstellerin Rechtsdienstleistungen i.S. von § 2 Abs. 1 RDG erbracht hat und danach in konkreten fremden Angelegenheiten mit einer rechtlichen Prüfung des Einzelfalls tätig war.
Selbst wenn zugunsten der Antragstellerin unterstellt wird, dass sie Rechtsdienstleistungen i.S. von § 2 Abs. 1 RDG erbracht hat, scheitert eine Anwendung von § 3a Abs. 4 Nr. 3 UStG zu ihren Gunsten zumindest daran, dass Schwerpunkt ihrer Leistungstätigkeit keine Rechtsdienstleistungen sind, wie sie hauptsächlich und gewöhnlich im Rahmen einer Anwaltstätigkeit erbracht werden. Hierfür spricht bereits, dass der Antragstellerin die Erbringung von Rechtsdienstleistungen weder nach den §§ 6 ff. RDG als nicht registrierte Person noch nach den §§ 10 ff. RDG als registrierte Person erlaubt war. Sie durfte daher gemäß § 5 Abs. 1 RDG Rechtsdienstleistungen nur im Zusammenhang mit einer anderen Tätigkeit erbringen, wenn die Rechtsdienstleistung als Nebenleistung zu einem „Berufs- oder Tätigkeitsbild“ gehört, wobei sich das Vorliegen einer Nebenleistung nach ihrem Inhalt, dem Umfang und dem sachlichen Zusammenhang mit der Haupttätigkeit unter Berücksichtigung der Rechtskenntnisse, die für die Haupttätigkeit erforderlich sind, beurteilt.
Im Rahmen der im Aussetzungsverfahren gebotenen summarischen Prüfung ist dabei davon auszugehen, dass die Antragstellerin die ihr nach dem RDG zustehenden Befugnisse nicht überschritten hat. Soweit sie Rechtsdienstleistungen erbracht haben sollte, handelte es sich daher bei diesen nur um „Nebenleistungen“ zu der Haupttätigkeit eines gewerblichen Schadensregulierers. Dass nur eine Nebenleistung und damit nur ein Teilaspekt mit einer durch Rechtsanwälte erbrachten Leistung vergleichbar ist, reicht indes zur Begründung einer ähnlichen Leistung nicht aus.
Bundesfinanzhof, Beschluss vom 20. Juli 2012 – V B 82/11
- vgl. z.B. BFH, Urteil vom 09.02.2012 – V R 20/11, juris[↩]
- Richtlinie des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem 2006/112/EG[↩]
- zur Bestimmung der Person des Leistungsempfängers nach dem der Leistung zugrunde liegenden Rechtsverhältnis vgl. z.B. BFH, Urteil vom 18.02.2009 – V R 82/07, BFHE 225, 198, BStBl II 2009, 876, unter II.02.a aa[↩]
- EuGH, Urteile vom 16.09.1997 – C-145/96 [von Hoffmann], Slg. 1997, I-4857 Rdnr. 15; und vom 07.10.2010 – C-222/09 [Kronospan Mielec], BFH/NV 2010, 2377 Rdnr.19[↩]
- EuGH, Urteile von Hoffmann in Slg. 1997, I-4857 Rdnr. 16; und Kronospan Mielec in BFH/NV 2010, 2377 Rdnr.20; BFH, Urteil vom 10.11.2010 – V R 40/09, BFH/NV 2011, 1026, unter II.1.c[↩]
- vgl. EuGH, Urteile vom 06.03.1997 – C-167/95 [Linthorst, Pouwels en J. Scheren], Slg. 1997, I-1195 Rdnrn. 19 bis 22; von Hoffmann in Slg. 1997, I-4857 Rdnrn. 20 und 21; und vom 06.12.2007 – C-401/06 [Kommission/Deutschland], Slg. 2007, I-10609 Rdnr. 31[↩]
- EuGH, Urteil Kommission/Deutschland in Slg.2007, I10609 Rdnr. 39[↩]