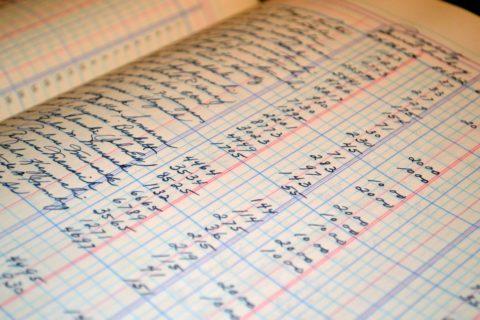Ein Kreditinstitut muss Steuererstattungen des Finanzamtes, die vom Finanzamt auf ein gekündigtes Girokonto überwiesen wurden, nicht zurückerstatten. Mit dieser Begründung gab jetzt der Bundesfinanzhof einer Bank Recht, die sich geweigert hatte, dem Finanzamt einen Betrag zurückzuzahlen, der als Steuererstattung auf ein von der Bank bereits gekündigtes Konto eines Kunden überwiesen worden war. Die Bank hatte den Betrag zunächst auf diesem Konto verbucht, dann auf einem internen Verrechnungskonto hinterlegt und ihn später auf entsprechende Anforderung an den Insolvenzverwalter ihres früheren Kunden ausgezahlt.

In erster Instanz vor dem Finanzgericht Berlin-Brandenburg hatte die Bank mit ihrer Klage gegen die Rückforderung des Finanzamt keinen Erfolg1. Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg bezog sich dabei auf frühere Entscheidungen des Bundesfinanzofs, in denen die Rückforderung von der Bank für rechtmäßig angesehen worden war, wenn das Finanzamt die Erstattung auf ein nicht mehr bestehendes Konto überwiesen hatte2.
Der Bundesfinanzhof stellte nun klar, dass die Bank, die zivilrechtlich auch nach Kündigung eines Girokontos berechtigt ist, eingehende Zahlungen für ihren früheren Kunden entgegenzunehmen, jedenfalls dann als bloße Zahlstelle zwischen dem Finanzamt und ihrem Kunden fungiert, wenn sie den Betrag pflichtgemäß für den Kunden verbucht bzw. an diesen auszahlt. Da folglich nicht sie selbst die Empfängerin der Leistung des Finanzamtes ist – das Finanzamt wollte ja nicht an die Bank, sondern an den Steuerpflichtigen zahlen – kann das Finanzamt von ihr auch keine Rückzahlung des überwiesenen Betrags verlangen.
Der Rückzahlungsanspruch des Finanzamtes gegen die Bank scheitert daran, dass nicht die Bank, sondern der Steuerpflichtige als Inhaber des Erstattungsanspruchs Empfängerin der vom Finanzamt bewirkten Leistung ist.
Wie der Bundesfinanzhof bereits in früheren Entscheidungen ausgeführt hat3, ist in den Fällen, in denen an einem Erstattungsvorgang mehrere Personen beteiligt sind, derjenige Schuldner des abgabenrechtlichen Rückzahlungsanspruchs, zu dessen Gunsten erkennbar die Zahlung geleistet wurde, die zurückgefordert wird. Dies ist in der Regel derjenige, demgegenüber die Finanzbehörde ihre –vermeintliche oder tatsächlich bestehende– abgabenrechtliche Verpflichtung erfüllen will. Ein Dritter ist folglich, obgleich tatsächlicher Empfänger einer Zahlung, dann nicht Leistungsempfänger, wenn er lediglich als Zahlstelle benannt worden ist bzw. das Finanzamt aufgrund einer Zahlungsanweisung des Erstattungsberechtigten an ihn eine Erstattung gezahlt hat. Denn in einem solchen Fall will das Finanzamt erkennbar nicht mit befreiender Wirkung zu dessen Gunsten leisten, sondern es erbringt seine Leistung mit dem Willen, eine Forderung gegenüber dem steuerlichen Rechtsinhaber zu erfüllen.
Ist in den Zahlungsvorgang bei einer Steuererstattung ein vom Steuerpflichtigen angegebenes Kreditinstitut eingeschaltet, so ist im Regelfall davon auszugehen, dass das Finanzamt mit der Überweisung nicht zu dessen Gunsten, sondern mit befreiender Wirkung gegenüber dem Anspruchsberechtigten, der das Konto angegeben hat, leisten will. Das Kreditinstitut ist nicht Leistungsempfänger, sondern lediglich die vom Steuerpflichtigen bezeichnete Zahlstelle.
So liegt es im Streitfall. Das Finanzamt wollte mit der Überweisung auf das von dem Steuerpflichtigen benannte Konto bei der Bank an den Steuerpflichtigen leisten und die Bank hat sich –wie aus der Verbuchung des Betrags auf das bei ihr noch geführte Konto des Steuerpflichtigen und der späteren Herausgabe des Habensaldos an den Insolvenzverwalter ersichtlich– als Zahlstelle des Steuerpflichtigen verstanden. Sie war nicht Leistungsempfängerin i.S. des § 37 Abs. 2 Satz 1 AO.
Etwas anderes ergibt sich, so der Bundesfinanzhof weiter, im Streitfall nicht daraus, dass die Bank das Girokonto des Steuerpflichtigen vor Eingang der Überweisung des Finanzamtes gekündigt hatte. Zwar hat der Bundesfinanzhof in zwei früheren Entscheidungen2 die Rückforderung von einem Kreditinstitut für rechtmäßig erachtet, wenn das Finanzamt die Erstattung auf ein nicht mehr bestehendes Konto überwiesen hat. Die diesen Entscheidungen zugrunde liegenden Sachverhalte unterscheiden sich aber vom Streitfall dadurch, dass dort das Kreditinstitut das Konto bereits einige Zeit vor der Überweisung gekündigt und den Überweisungsbetrag mit Forderungen aus diesem Konto verrechnet hatte. Dem lag die Erwägung zugrunde, dass das Kreditinstitut, das wegen der nach Kündigung noch fortbestehenden Nachwirkungen des Girovertrags berechtigt sei, noch eingehende Überweisungsbeträge für seine ehemaligen Kunden entgegenzunehmen, mit der Aufrechnung eine eigene Zweckbestimmung der Leistung gegenüber seinen Kunden treffe und nicht lediglich als Zahlstelle fungiere; dadurch sei es selbst Leistungsempfänger geworden.
Entgegen der Auffassung der Vorinstnaz, des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg, lässt sich mit diesen Entscheidungen nicht begründen, dass auch im Streitfall die Bank, die das gekündigte Konto mit einem Habensaldo geschlossen und das Geld an den Insolvenzverwalter über das Vermögen der GmbH weitergeleitet hat, Leistungsempfängerin ist. Die Bank hat sich vielmehr so verhalten, wie sie sich nach der zivilrechtlichen Rechtslage gegenüber ihrer früheren Kundin verhalten musste, nämlich als bloße Zahlstelle.
Der Bundesfinanzhof teilt insoweit ausdrücklich die Auffassung des Bundesgerichtshofs, dass die Bank des Überweisungsempfängers im mehrgliedrigen Überweisungsverkehr regelmäßig nur als Leistungsmittlerin, d.h. als Zahlstelle des Überweisungsempfängers handelt und als solche in keinerlei Leistungsverhältnis zu dem Überweisenden steht, so dass sie grundsätzlich auch nicht in die bereicherungsrechtliche Rückabwicklung einer Fehlüberweisung nach § 812 Abs. 1 BGB eingebunden ist. Dem Umstand, dass ein Girovertrag bei Eingang des Überweisungsbetrags bereits durch Kündigung erloschen ist, hat der BGH insoweit keine Bedeutung beigemessen. Mit dem Erlöschen des Girovertrags verliere das laufende Konto allerdings seine Eigenschaft als Zahlungsverkehrskonto. Die kontoführende Bank sei danach grundsätzlich nicht verpflichtet, nachträglich eingehende Beträge auf dem Konto zu verbuchen. Daraus folge jedoch nicht, dass die Bank des Begünstigten nach Erlöschen des Girovertrags nicht mehr als dessen Zahlstelle fungieren könne. Vielmehr sei sie auch bei einem erloschenen Girovertrag in dessen Nachwirkung noch befugt, im Interesse ihres früheren Kunden eingehende Zahlungen weiterhin für ihn entgegenzunehmen, müsse sie dann aber auf dem bisherigen Konto entsprechend § 676f Satz 1 BGB verbuchen bzw. nach § 667 BGB herausgeben. Handele die Bank dementsprechend, so sei dieses Vorgehen als bloße Zahlstellentätigkeit zu werten: Es stehe außer Zweifel, dass sie bei der Entgegennahme des Überweisungsbetrags und dessen Verbuchung auf dem internen weitergeführten Konto für den früheren Kontoinhaber handele und die Überweisung nicht etwa als Zahlungen an sich ansehe. Die von der Bank zunächst vorgenommene Verrechnung des eingegangenen Überweisungsbetrags mit dem Debet auf dem Konto des Kunden und die anschließende Herausgabe an den Insolvenzverwalter könne nicht anders verstanden werden4.
Diese Ausführungen des Bundesgerichtshof sind nicht ausschließlich auf das Innenverhältnis zwischen Bank und Bankkunden bezogen, da sie ausdrücklich den Bereicherungsanspruch des Überweisenden betreffen und die Bank insoweit als bloße Zahlstelle ausweisen. Sie sind auch auf den Rückzahlungsanspruch nach § 37 Abs. 2 AO übertragbar. Zwar können die §§ 812 ff. BGB auf den öffentlich-rechtlichen Rückzahlungsanspruch aus § 37 Abs. 2 AO keine unmittelbare Anwendung finden, da dieser Anspruch Ausdruck eines übergeordneten und allgemein herrschenden Prinzips ist, dass derjenige, der vom Staat ohne Rechtsgrund etwas erhalten hat, grundsätzlich verpflichtet ist, das Erhaltene zurückzuzahlen. Jedoch ist der Rechtsgedanke des § 812 Abs. 1 BGB auch im Rahmen des § 37 Abs. 2 AO zu beachten5.
Ausdrücklich offen gelassen hat der Bundesfinanzhof, ob im auf diese Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs für den hier nicht vorliegenden Fall einer nach Auflösung des Kontos vorgenommenen Verrechnung eines eingehenden Erstattungsbetrags mit eigenen Forderungen der Bank an der in seinen beiden früheren Entscheidungen angenommenen Rückzahlungsverpflichtung der Bank noch festzuhalten sei.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 10. November 2009 – VII R 6/09
- FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 04.06.2008 – 15 K 6215/05 B[↩]
- BFH, Beschlüsse vom 28.01.2004 – VII B 139/03, BFH/NV 2004, 762; und vom 06.06.2003 – VII B 262/02, BFH/NV 2003, 1532, m.w.N.[↩][↩]
- ständige Rechtsprechung, vgl. BFH, Urteil vom 30.08.2005 – VII R 64/04, BFHE 210, 219, BStBl II 2006, 353, m.w.N.[↩]
- BGH, Urteil vom 05.12.2006 – XI ZR 21/06, BGHZ 170, 121, NJW 2007, 914[↩]
- vgl. BFH, Urteil in BFHE 210, 219, BStBl II 2006, 353, m.w.N.[↩]