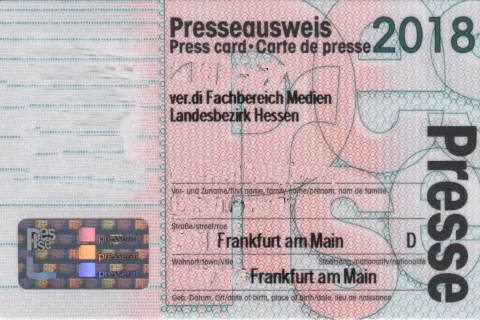Zum Umfang der gerichtlichen Abwägungskontrolle, wenn sich ein mittelbar betroffener Grundstückseigentümer gegen einen Planfeststellungsbeschluss zur Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen wendet, musste jetzt das Verwaltungsgericht Hannover Stellung nehmen:

Da ein eigentumsentziehender Zugriff auf das Grundstück der Antragsteller nicht vorgesehen ist, werden die Antragsteller von der sogenannten enteignungsrechtlichen Vorwirkung des Planfeststellungsbeschlusses nicht betroffen. Daher ist der gerichtliche Kontrollumfang von vornherein begrenzt auf Verstöße gegen jeweils die Antragsteller schützende Normen1. Eine (Ausnahme-)Situation, in der auch drittbetroffene Nachbarn eine vollständige Rechtskontrolle verlangen können, liegt nach Auffassung der Kammer nicht vor. Denn dass die planfestgestellten Hochwasserschutzmaßnahmen mit Sicherheit zu einem massiven und praktisch vollständigen Wertverlust führen, der das Eigentum der Antragsteller funktionslos werden ließe, erscheint der Kammer ausgeschlossen2.
Rechtsgrundlage des Planfeststellungsbeschlusses vom 27.09.11 sind die §§ 67, 68 WHG, 107 ff. NWG. Danach bedarf die von der Beigeladenen geplante Umgestaltung des östlichen Ihmeufers der Planfeststellung, die nur erteilt werden darf, wenn eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere eine erhebliche und dauerhafte, nicht ausgleichbare Erhöhung der Hochwasserrisiken oder eine Zerstörung natürlicher Rückhalteflächen, vor allen in Auwäldern, nicht zu erwarten ist (§ 68 Abs. 3 Nr. 1 WHG) und andere Anforderungen nach diesem Gesetz oder sonstigen öffentlichrechtlichen Vorschriften erfüllt werden (§ 68 Abs. 3 Nr. 2 WHG).
Nach der im vorläufigen Rechtsschutzverfahren durchzuführenden summarischen Prüfung leidet der Planfeststellungsbeschluss nicht an Rechtsfehlern, die die Antragsteller in ihren Rechten verletzen könnten. Für die planfestgestellten Hochwasserschutzmaßnahmen besteht eine Planrechtfertigung und die vom Antragsgegner getroffene Abwägungsentscheidung wird im Hinblick auf die rechtlich geschützten eigenen Belange der Antragsteller nicht zu beanstanden sein.
Das Hochwasserschutzvorhaben der Beigeladenen verfügt über die erforderliche Planrechtfertigung, deren Fehlen die Antragsteller auch als nur mittelbar betroffene Nachbarn rügen könnten3. Gerechtfertigt ist eine Planung nicht erst, wenn das Vorhaben alternativlos und zwingend erforderlich ist, sondern schon dann, wenn für das Vorhaben ein Bedarf besteht, d.h. wenn es gemessen an den Zielsetzungen des jeweiligen Fachgesetzes vernünftigerweise geboten ist4.“
Die von der beigeladenen Planungsbehörde im Flussabschnitt zwischen Leinert- und Legionsbrücke geplanten Maßnahmen (Aufweitung des Ihmeufers und Errichtung fester Hochwasserschutzmauern) sind vernünftigerweise geboten. Sie dienen dem Schutz weiter Teile der dicht bebauten Calenberger Neustadt vor Überflutungen während eines 100jährigen Hochwasserereignisses (HQ 100) und können sich wasserstandsmindernd Leine aufwärts bis nach Ricklingen auswirken. Denn mit den Vorlandabgrabungen zwischen Leinert- und Legionsbrücke wird die einzige auf dem Stadtgebiet der Beigeladenen noch bestehende Engstelle im Verlauf der Leine/Ihme beseitigt und so der Wasserabfluss beschleunigt. Sowohl oberhalb als auch unterhalb dieser Brücken stehen dem Fluss Durchflussbreiten von 85 m bis 100 m zur Verfügung, zwischen den beiden Brücken jedoch nur etwa 45 m. Dies liegt nach den Erläuterungen der Beigeladenen daran, dass die seit Beginn des letzten Jahrhunderts geplante durchgängige Aufweitung des Ihmeprofils hier noch nicht umgesetzt und stattdessen das rechtsseitige Ufer bis unmittelbar an den Fluss künstlich aufgeschüttet worden ist. Um diese Engstelle zu beseitigen, wurde bereits die im fraglichen Flussabschnitt gelegene BennoOhnesorgBrücke aufgeweitet. Allein durch diese Maßnahme kann der bestehenden „Flaschenhalseffekt“ jedoch nicht beseitigt werden. Erst durch die weitgehende Beseitigung der künstlichen Aufschüttungen können der Flussverlauf der Ihme seinem natürlichen Zustand wieder angenähert und die HQ 100 Hochwasserstände um bis zu 39 cm reduziert werden. Dadurch wird nicht nur die dicht bebaute Calenberger Neustadt entlastet, sondern es werden auch die Wasserstände oberhalb der Legionsbrücke bis Hemmingen deutlich abgesenkt, so dass bislang vom Hochwasser betroffene Flächen gar nicht mehr bzw. deutlich weniger hoch überflutet werden. Ein HQ 100 Hochwasser ist nach § 74 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 WHG als ein Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit einzustufen. Gebiete, die von einem derartigen Hochwasser betroffen sind, sind nach § 73 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 WHG als Überschwemmungsgebiete festzusetzen, in denen ein grundsätzliches Bauverbot gilt, § 78 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 WHG. Diese rechtlichen Vorschriften zeigen, dass der Gesetzgeber dem Schutz vor einem HQ 100 Hochwasser besondere Bedeutung beimisst5. Dieser gesetzlichen Wertung trägt der vorliegende Plan Rechnung.
Letztlich bestreiten auch die Antragsteller nicht, dass für die Leine/Ihme weitere Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich sind. Sie sind vielmehr mit den konkret planfestgestellten Maßnahmen nicht einverstanden und machen geltend, effektiver Hochwasserschutz könne auch auf andere Weise und insbesondere unter Erhalt des ihrem Wohnhaus gegenüberliegenden Grünzuges erreicht werden; der Antragsgegner habe insoweit eine fehlerhafte Auswahlentscheidung getroffen.
Die Kammer geht jedoch nach summarischer Prüfung davon aus, dass der Antragsgegner die von den Antragstellern favorisierten Alternativmöglichkeiten zum Hochwasserschutz in rechtlich nicht zu beanstandender Weise verworfen hat. Rechtsfehler zulasten der Antragsteller sind im Rahmen der fachplanerischen Abwägung der öffentlichen und privaten Belange jedenfalls nicht erkennbar. Ein relevanter Abwägungsfehler läge nur vor, wenn eine Abwägung überhaupt nicht stattgefunden hätte, wenn in die Abwägung nicht an Belangen eingestellt worden wäre, was nach Lage der Dinge in sie eingestellt werden musste, wenn die Bedeutung der betroffenen Belange verkannt oder der Ausgleich zwischen ihnen in einer Weise vorgenommen worden wäre, der zur objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange außer Verhältnis steht6.
Eine umfassende gerichtliche Abwägungskontrolle anhand dieses Maßstabs findet allerdings nur für den durch die Planung unmittelbar in seinem Eigentumsrecht Betroffenen statt. Eigentümer wie die Antragsteller, deren Grundstück für das Vorhaben nicht in Anspruch genommen werden soll, können nur eine eingeschränkte gerichtliche Überprüfung der planerischen Abwägung verlangen und zwar im Hinblick auf die rechtlich geschützten eigenen Belange und – wegen der insoweit bestehenden Wechselbeziehung – der diesen Belangen gegenübergestellten, für das Vorhaben streitenden Belange7. Für die von den Antragstellern verlangte Alternativenüberprüfung bedeutet das konkret: Die vom Antragsgegner getroffene Auswahlentscheidung verletzt subjektivöffentliche Rechte der Antragsteller erst dann, wenn sich andere Alternativen des Hochwasserschutzes unter Berücksichtigung der Belange der Antragsteller eindeutig als die besseren, weil öffentliche und private Belange insgesamt schonenderen darstellen würden, wenn sich mit anderen Worten eine die Belange der Antragsteller schonendere Alternative dem Antragsgegner als eindeutig bessere Lösung hätte aufdrängen müssen7.
Nach diesen Vorgaben ist die planerische Auswahlentscheidung des Antragsgegners nicht zu beanstanden.
Soweit die Antragsteller einen Verstoß der planfestgestellten Maßnahmen gegen § 5 Abs. 1 WHG rügen, machen sie keinen eigenen Belang geltend. Nach dieser Vorschrift ist jede Person bei Einwirkungen auf ein Gewässer dazu verpflichtet, die den Umständen entsprechende Sorgfalt anzuwenden, um u. a. eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden (Abs. 1 Nr. 4). Ob ein derartiger Verstoß vorliegt, weil mit der geplanten Aufweitung des Ihmeprofils auch ein erhöhter Wasserabfluss einhergeht, kann nach Auffassung der Kammer dahinstehen. Denn nachbarschützende Wirkung hat § 5 WHG wegen seines Gemeinwohlbezuges und seines pauschalen Charakters nicht8.
Entsprechendes gilt für den von den Antragstellern gerügten Verstoß gegen § 77 WHG. Nach dieser Vorschrift, die § 5 WHG konkretisiert9, sind Überschwemmungsgebiete in ihrer Funktion als Rückhalteflächen zu erhalten. Einen Verstoß gegen diese Vorschrift vermag die Kammer nicht zu erkennen. Die Antragsteller machen zwar insoweit geltend, mit der geplanten Aufweitung des Ihmeprofils sei ein erhöhter Wasserdurchfluss verbunden, so dass ein Teil des bisher oberhalb Hannovers vorhandenen HochwasserRückhalteraums der Leineaue nicht mehr genutzt und auch die Calenberger Neustadt nicht mehr überschwemmt werde. Die dicht bebaute Calenberger Neustadt wird zwar bei einem HQ 100 Hochwasser überflutet und gehört damit begrifflich zu den Überschwemmungsgebieten i. S. d. § 76 Abs. 1 WHG. Ihr kommt jedoch nicht die Funktion einer natürlichen Rückhaltefläche zu, auf der sich Hochwasser zum Schutz bebauter Gebiete ungehindert ausbreiten können soll. Sie ist vielmehr ein Gebiet, und das zum Schutz von Leib, Leben und Eigentum seiner Bewohner vor Hochwasser geschützt werden muss. Aber auch die oberhalb Hannovers gelegene Leineaue wird durch die planfestgestellten Maßnahmen in ihrer Funktion als Rückhaltefläche nicht angetastet. Die Leineaue bleibt in ihrer bisherigen Funktion bestehen, sie wird im Hochwasserfall allenfalls nicht mehr so hoch überflutet werden wie bislang. Im Übrigen sind Anhaltspunkte dafür, dass die Antragsteller, die als Bewohner der Calenberger Neustadt von den geplanten Schutzmaßnahmen bei einem HQ 100 Hochwasserereignis unmittelbar profitieren, durch weniger hoch überschwemmte Rückhalteflächen oberhalb Hannovers rücksichtslos in ihrem Eigentumsrecht beeinträchtigt werden könnten, nicht ersichtlich.
Ob die planfestgestellten Maßnahmen und der damit einhergehende Verlust an Bäumen und Lebensraum für – bedrohte – Tiere mit den Natur- und Artenschutzbestimmungen nationaler und europarechtlicher Natur vereinbar sind, insbesondere ob ausreichende Ersatzmaßnahmen angeordnet wurden, kann dahinstehen. Denn diese Vorschriften dienen ausnahmslos nicht dem Schutz privater Belange, so dass die Antragsteller selbst einen Verstoß gegen diese Vorschriften nicht als eigenen Belang geltend machen können10.
Soweit die Antragsteller rügen, die planfestgestellten Maßnahmen beeinträchtigten das von ihnen bewohnte Baudenkmal, machen sie die Beeinträchtigung eines u. U. eigenen Belangs geltend. Denn § 8 Satz 1 NDSchG kann für die Antragsteller als Bewohner eines Baudenkmals in manchen Fallkonstellationen Nachbarschutz vermitteln. Nach dieser Vorschrift muss der Eigentümer eines geschützten Kulturdenkmals jedenfalls dann berechtigt sein, die denkmalrechtliche Genehmigung eines benachbarten Vorhabens anzufechten, wenn das Vorhaben die Denkmalwürdigkeit seines Anwesens möglicherweise erheblich beeinträchtigt11. Das Nds. OVG12 sieht in § 8 Satz 1 NDSchG eine Abwehrrechtsposition für den betroffenen Denkmaleigentümer, wenn durch die im Streit stehende Baumaßnahme die jeweilige besondere Wirkung seines Baudenkmals, welche es aufgrund eines der Denkmal begründenden Gesichtspunkte ausübt, geschmälert wird. Die in die Nähe eines Baudenkmals rückende Anlage darf es nicht gleichsam erdrücken, verdrängen, übertönen oder die gebotene Achtung gegenüber den Werten außer Acht lassen, welche dieses Denkmal verkörpert13.
Nach dem vorliegenden Lageplan über die Neugestaltung der Grünflächen zwischen E. und Ihme vermag die Kammer eine Verletzung des § 8 Satz 1 NDSchG nicht zu erkennen. Direkt gegenüber dem Wohnhaus der Antragsteller sieht der Plan den Erhalt des Kunstwerks „Die Große Begehbare“ auf einer asphaltierten Fläche vor. Weiter werden im Abstand von 18 m bzw. 33 m zur Grundstücksgrenze bis max. 0,60 m hohe Hochwasserschutzmauern geplant. Einer derart niedrigen Mauer kann eine einschnürende oder optische bedrängende Wirkung nicht beigemessen werden14. Dabei kann dahinstehen, ob die Befürchtung der Antragsteller, die Hochwasserschutzmauern würden über kurz oder lang mit Graffiti vollgeschmiert, zutrifft und ihre denkmalgeschützte Villa insoweit beeinträchtigt werden könnte. Denn derartige Graffiti sind nicht Gegenstand des angefochtenen Planfeststellungsbeschlusses.
Auch durch die von den Antragstellern beanstandete Neugestaltung des Grünzuges nach Beendigung der Abgrabungsarbeiten kann ihr Baudenkmal nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Nach dem landschaftspflegerischen Begleitplan sollen direkt im Anschluss an die Asphaltfläche der „Großen Begehbaren“ Gehölze/Laubbäume angepflanzt. Zwischen Radweg und Ihmeufer sollen sich Vegetationsbestände aus Gräsern, Stauden und Kräutern entwickeln. Die von den Antragstellern befürchtete „Wüstenlandschaft“ wird somit nicht entstehen. Zwar werden die Antragsteller den liebgewonnenen Ausblick auf zahlreiche grüne Bäume verlieren und der städtebaulich umstrittene Komplex des Ihmezentrums wird von ihren Fenstern aus sichtbar werden. Eine Sichtbeziehung, die die Denkmalwertigkeit der „Villa F. “ beeinträchtigen könnte, tritt damit aber nicht ein, weil Ihmezentrum und „Villa F. “ nur von sehr entfernten Standpunkten aus gemeinsam in den Blick genommen werden können. Die am Verfahren beteiligte Untere Denkmalschutzbehörde hat insoweit auch keinerlei Bedenken geäußert.
Als dem Grunde nach rügefähigen eigenen Belang können die Antragsteller jedoch geltend machen, dass mit Verwirklichung der planfestgestellten Maßnahmen eine Wertminderung bzw. eine Minderung des Wohnwertes ihres eigenen Grundstücks eintreten werde1. Ein für das gesamte Wohngebiet wichtiger Grünzug gehe verloren. In der Umweltverträglichkeitsstudie würden daher auch erhebliche Umweltbeeinträchtigungen konstatiert. Außerdem werde der Blick frei auf das langsam verfallende Ihmezentrum auf der anderen Seite der Ihme. Insoweit unterstellt die Kammer zugunsten der Antragsteller, dass eine – substantiiert nicht vorgetragene – Wertminderung ihres Grundstücks mit der Umgestaltung des Ihmeufers eintreten wird. Doch auch unter Berücksichtigung dieses Belanges drängen sich die von den Antragstellern vorgeschlagenen Hochwasserschutzalternativen nicht als eindeutig bessere Lösungen auf.
Mit der von den Antragstellern vorgeschlagenen „Nullvariante“ (Verzicht auf die Vorlandabgrabungen und die Errichtung der Hochwasserschutzmauern) hat sich der Antragsgegner auseinander gesetzt und sie in rechtlich nicht zu beanstandender Weise als für den Hochwasserschutz nicht ausreichend ausgeschlossen. Für die Kammer nachvollziehbar führt der Antragsgegner dazu aus, dass die bereits erfolgte Aufweitung der BennoOhnesorgBrücke allein nicht ausreicht, um eine Überflutung der Calenberger Neustadt im Fall eines HQ 100 Hochwassers zu verhindern. Diese Maßnahme wirke sich wasserstandsmindernd nur in einem Abschnitt von etwa 250 m oberhalb der Brücke aus. Die angestrebte Absenkung der Hochwasserstände um 39 cm könne nur mit der vollständigen Beseitigung der Abflussengstelle zwischen Leinert- und Legionsbrücke erreicht werden. Doch selbst dann ist der Schutz der Calenberger Neustadt noch nicht sichergestellt: Die Errichtung von Hochwasserschutzmauern ist zusätzlich erforderlich, weil unterhalb der Leinertbrücke keine Abflussengstelle mehr besteht, die noch beseitigt werden könnte.
Die „Nullvariante“ durfte der Antragsgegner auch im Hinblick auf den für 2015 vorgesehenen RisikoManagementplan für das Gesamteinzugsgebiet der Leine ausschließen. Der Planfeststellungsbeschluss setzt sich auch mit diesem Einwand der Antragsteller auseinander und legt plausibel dar, dass die im Oberlauf der Leine geschaffenen Rückhaltemöglichkeiten15 bei der Berechnung des HQ 100 Hochwassers bereits berücksichtigt worden sind. Weitere Rückhaltemöglichkeiten könnten die Lage für Hannover zwar entspannen, lägen aber in ungewisser Zukunft. Außerdem ziele die Schaffung weiterer Retentionsflächen auch darauf ab, mit der im Zuge des Klimawandels erwarteten Zunahme hochwasserrelevanter Niederschläge fertig zu werden. Der Antragsgegner geht daher zu Recht davon aus, dass effektiver Hochwasserschutz nur durch eine Kombination der planfestgestellten Maßnahmen mit der Schaffung weiterer Retentionsflächen am Oberlauf der Leine geschaffen werden kann.
Der von den Antragstellern vorgeschlagene Verzicht auf die Vorlandabgrabungen und die ausschließliche Errichtung – mobiler – Hochwasserschutzmauern drängt sich ebenfalls nicht als eindeutig bessere Lösung auf. Denn allein durch die Errichtung von Hochwasserschutzmauern können die Hochwasserstände nicht abgesenkt werden, sie würden in einigen Bereichen sogar eher noch höher ausfallen. Weiter weist der Antragsgegner zu Recht auf die bestehende räumliche Enge mit der nah an den Fluss herangerückten dichten Bebauung der Calenberger Neustadt hin, die grundsätzlich unterschiedliche Varianten (etwa einen Deichbau) schon praktisch unmöglich mache. Ausreichend hohe Hochwasserschutzmauern mit Spundwänden seien zwar praktisch möglich aber technisch aufwendig und kostenintensiv und würden insgesamt nicht den Wirkungsgrad erzielen, den die Beseitigung der Abflussengstelle nach sich ziehen wird. Außerdem würde die Errichtung von Hochwasserschutzmauer ebenfalls Belange der Antragsteller beeinträchtigen. Für die Errichtung der Hochwasserschutzmauern sind Spundwände als Fundamente erforderlich, zu deren Erstellung ebenfalls zahlreiche Bäume fallen müssten. Zudem würden die Antragsteller und die weiteren Anlieger der E. bei Errichtung einer ausreichend hohen festen Hochwasserschutzmauer nahezu „eingemauert“ und den bisher bestehenden Blick über den Grünzug und die Ihme verlieren.
Entsprechendes gilt auch für die von den Antragstellern vorgeschlagenen mobilen Hochwasserschutzwände. Diese würden zwar die bestehenden Blickbeziehungen weitgehend unangetastet lassen. Der Antragsgegner weist jedoch zu Recht darauf hin, dass auch für derartige Mauern Fundamente und Spundwände gebaut und Bäume gefällt werden müssten. Wegen der zusätzlichen Nachteile dieser Variante (höhere Kosten, höherer Personalaufwand, hohes Versagensrisiko u. ä.) sind mobile Wände nur wenig effektive Hochwasserschutzmöglichkeiten und drängen sich nicht als eindeutig bessere Variante auf.
Die weiteren von den Antragstellern befürchteten Beeinträchtigungen ihres Wohneigentums, die sie ebenfalls als eigene Belange geltend machen können, stellen die vom Antragsgegner getroffene Auswahlentscheidung ebenfalls nicht in Frage. Der Antragsgegner hat sich mit den befürchteten Lärm- und Staubbelastungen während der Bauzeit und den eventuellen Setzungsschäden durch Rammen der Spundwände ebenso auseinandergesetzt wie mit den befürchteten Veränderungen des Grundwasserspiegels, die zu einer Vernässung der Kellerräume der Antragsteller führen könnten. Diese Bedenken sind im angefochtenen Planfeststellungsbeschluss weitgehend – teils durch Fachgutachten belegt – ausgeräumt worden.
Mit der Nebenbestimmung I.05.01. 4 zum Planfeststellungsbeschluss wurde der Beigeladenen aufgegeben, die allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm), die 32. BImSchV (Geräte- und Baumaschinen – LärmschutzVO) und die 16. BImschV (Baustellenverkehr auf öffentlichen Straßen) zu beachten und die dort genannten Grenzwerte einzuhalten. Zudem hat die Beigeladene bereits in ihrem Antrag die Arbeits- und Transportzeiten auf die Werktage außerhalb der Nachtzeit beschränkt. Der Antragsgegner ist auf dieser Grundlage zu dem Ergebnis gelangt, dass die Antragsteller während der Bauphase keinen unzumutbaren Immissionen i. S. d. § 22 BImSchG ausgesetzt werden. Dieser Einschätzung sind die Antragsteller im gerichtlichen Verfahren substantiiert nicht entgegengetreten.
Zu den befürchteten Setzungsschäden führt der Antragsgegner aus, es sei nach bisherigem Kenntnisstand nicht zu erwarten, dass es durch die durchzuführenden Rammarbeiten zu Schäden am Haus der Antragsteller kommen könne. Diese Einschätzung erscheint der Kammer plausibel, weil die Spundwand nur durch die Aufschüttung getrieben werden muss, und nicht durch gewachsene Bodenschichten wie Mergel oder Lehm, die Schwingungen weit tragen. Als Vorsichtsmaßnahme hat der Antragsgegner unter Nebenbestimmung I.05.01.26 dennoch angeordnet, dass vor Beginn der Baumaßnahme eine Bestandsaufnahme der Bauwerkssubstanz und des Zustandes der Kellerräume durchzuführen sei.
Zu den Auswirkungen der Hochwasserschutzmaßnahmen auf die Grundwasserverhältnisse hat der Antragsgegner auf der Grundlage des Gutachtens der Ingenieurgesellschaft Heidt Peters mbH festgestellt, dass es für die Befürchtungen der Antragsteller keine Grundlage gibt. Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass die planfestgestellten Maßnahmen außerhalb der Hochwasserzeiten keinerlei Auswirkungen auf den Grundwasserspiegel haben, u. a. deshalb, weil die Gründungsspundwand der geplanten Hochwasserschutzwand nicht bis in den Auelehm niedergebracht wird, auf dem das Grundwasser in „normalen“ Zeiten ansteht. Das Gutachten kommt für Hochwasserzeiten zu dem Ergebnis, dass durch die geplanten Maßnahmen die Grundwasserstände im Binnenland nicht angehoben werden. Im Nahbereich der Böschung, also im Bereich des Grundstücks der Antragsteller, stellen sich sogar niedrigere Grundwasserstände ein. Der Vorstellung der Antragsteller, die unter der Hochwasserschutzwand geplante Spundwand werde einen „Rückstau“ des Grundwassers bewirken und zu einem Anstieg des Grundwasserspiegels führen, fehlt somit die Tatsachengrundlage. Substantiierte Einwendungen gegen die Richtigkeit der gutachterlichen Feststellungen haben die Antragsteller nicht vorgebracht. Außerdem hat der Antragsgegner als Vorsichtsmaßnahme auch in dieser Hinsicht die o. g. Bestandsaufnahme angeordnet.
Im Übrigen erfordert die von den Antragstellern favorisierte Hochwasserschutzvariante der mobilen Hochwasserschutzwände ebenfalls die Errichtung von Fundamenten und Spundwänden, so dass sich diese Variante im Hinblick auf befürchtete Grundwasser- bzw. Setzungsschäden gerade nicht als eindeutig schonender erweist. Zudem besteht für den Fall, dass im Zuge der Bauarbeiten wider Erwarten und aller Schutzauflagen zum Trotz Beeinträchtigungen der Antragsteller eintreten, die Möglichkeit, der Beigeladenen weitere Vorkehrungen aufzuerlegen, die zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer erforderlich sind, § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG. Aus dieser Regelung können die Antragsteller aber in der Regel nur einen Anspruch auf Planergänzung herleiten16 und gegebenenfalls weitere Schutzauflagen gegen Lärm, Staub oder einwirkendes Grundwasser zu ihren Gunsten verlangen. Ein derartiger Ergänzungsanspruch würde jedoch auf die Ausgewogenheit der Planung nicht durchschlagen und wäre im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes von vornherein nicht geeignet, einen Aussetzungsanspruch zu begründen17. Evtl. Schadensersatzansprüche wären in einem gesonderten Verfahren geltend zu machen.
Verwaltungsgericht Hannover, Beschluss vom 10. Januar 2012 – 4 B 5078/11
- vgl. Nds. OVG, Beschluss vom 09.03.11, a. a. O.[↩][↩]
- vgl. dazu Nds. OVG,Beschluss vom 08.01.09 – 13 LA 13/08; diese Entscheidung betraf ein Grundstück, dass durch die benachbarte Nassauskiesung beinahe zur Insel wurde[↩]
- so Nds. OVG, Beschluss vom 05.03.08 – 7 MS 115/07; Beschluss vom 09.03.11, a. a. O.[↩]
- BVerwG, Urteil vom 28.12.09 – 9 B 26/09, m. w. N.[↩]
- vgl. auch VG Hannover, Beschluss vom 20.12.11 – 12 B 3203/11 [↩]
- dazu grundsätzlich BVerwG, Urteil vom 14.02.75 – IV C 21.74[↩]
- so Nds. OVG, Beschluss vom 09.03.11, a. a. O.[↩][↩]
- Czychowski/Reinhardt, WGH, Kommentar 2010, § 5 Rn 16[↩]
- vgl. Czychowski/Reinhardt, WGH, Kommentar 2010, § 77 Rn 3[↩]
- so BVerwG, Urteil vom 26.04.07 – 4 C 12/05[↩]
- so BVerwG, Urteil vom 21.04.09 – 4 C 3.08[↩]
- Beschluss vom 14.03.07 – 1 ME 222/06 , BauR 2007, 1192 m. w. N. hinsichtlich Rspr. und Lit.[↩]
- vgl. Schmaltz/Wiechert, NDSchG, Kommentar, 1998, § 8 Rdn. 6[↩]
- vgl. Nds. OVG, Urteil vom 15.04.11 – 1 KN 356/07, zu einen gegenüber einer denkmalgeschützten Villa errichteten 6 m hohen Lärmschutzwall[↩]
- etwa die Harztalsperren oder das Rückhaltebecken bei Salzderhelden[↩]
- so BVerwG, Urteil vom 03.05.11 – 7 A 9/09[↩]
- so Nds. OVG, Beschluss vom 05.03.08 – 7 MS 115/07[↩]