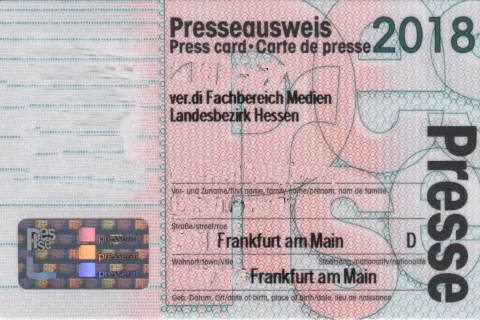Das Verpflichtungsbegehren eines Bauantragstellers, der gegen die Zurückstellung seines Bauantrags nach § 15 Abs. 1 Satz 1 BauGB Widerspruch eingelegt und danach Untätigkeitsklage auf Erteilung der Baugenehmigung erhoben hat, erledigt sich nicht dadurch, dass die sofortige Vollziehung des Zurückstellungsbescheides angeordnet wird.

Nach § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO spricht das Gericht für den Fall, dass sich der angegriffene Verwaltungsakt erledigt hat, auf Antrag durch Urteil aus, dass der Verwaltungsakt rechtswidrig gewesen ist, wenn der Kläger ein berechtigtes Interesse an dieser Feststellung hat. Die auf Anfechtungsklagen zugeschnittene Bestimmung ist nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts auf Verpflichtungsklagen entsprechend anwendbar1 und zwar auch dann, wenn – wie hier – die Verpflichtungsklage als Untätigkeitsklage erhoben worden ist2. Da die Fortsetzungsfeststellungsklage u.a. dem Zweck dient zu verhindern, dass ein Kläger um die „Früchte“ seiner bisherigen Prozessführung gebracht wird3, ist das Verpflichtungsbegehren erledigt, wenn es nach Klageerhebung aus dem Kläger nicht zurechenbaren Gründen unzulässig oder unbegründet wurde, wenn also das Rechtsschutzziel aus Gründen, die nicht in der Einflusssphäre des Klägers liegen, nicht mehr zu erlangen ist, weil es entweder außerhalb des Prozesses erreicht wurde oder überhaupt nicht mehr erreicht werden kann4. Letzteres ist der Fall, wenn eine nachträgliche Änderung der Sach- oder Rechtslage zum Erlöschen eines Anspruchs führt5.
Durch die Zurückstellung des Bauantrags (§ 15 BauGB) erlischt ein Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung nicht. Die Zurückstellung ist ein Institut des formellen Baurechts, das es ermöglicht, ein Baugenehmigungsverfahren für einen Zeitraum bis zu 12 Monaten auszusetzen und damit vorübergehend offen zu halten6, wenn eine Veränderungssperre nach § 14 BauGB nicht beschlossen worden ist, obwohl die Voraussetzungen gegeben sind, oder wenn eine beschlossene Veränderungssperre noch nicht in Kraft getreten ist und zu befürchten ist, dass die Durchführung der Planung durch das Vorhaben unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden würde. Anders als eine in Kraft befindliche Veränderungssperre berechtigt die Zurückstellung die Baugenehmigungsbehörde nicht zur Ablehnung eines Bauantrags, sondern nur dazu, die Entscheidung über den Antrag zeitlich befristet aufzuschieben7. Zwar kann der Bauantragsteller gegen die Zurückstellung Widerspruch einlegen mit der Folge, dass die Behörde wegen der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs (§ 80 Abs. 1 Satz 1 VwGO) zur unverzüglichen Weiterbearbeitung des Bauantrags verpflichtet ist; die Behörde kann dies jedoch verhindern, wenn sie – wie hier geschehen – die sofortige Vollziehung der Zurückstellung anordnet.
Solange die Pflicht der Baugenehmigungsbehörde zur Bearbeitung des Bauantrags ausgesetzt ist, ist die Feststellung, dass das Klageziel überhaupt nicht mehr erreicht werden kann, nicht möglich. Sie lässt sich erst treffen, wenn die bauplanungsrechtlichen Grundlagen des fraglichen Vorhabens in einer Weise geändert worden sind, die zur Unzulässigkeit des Vorhabens führten. In diesem Fall ist der Zurückstellungsbescheid durch einen Versagungsbescheid zu ersetzen8. Zwar kann die Verpflichtungsklage auch während des Schwebezustands keinen Erfolg haben9; daraus folgt aber nicht, dass der Kläger aus Anlass der Anordnung der sofortigen Vollziehung des Zurückstellungsbescheides seinen Verpflichtungsantrag auf einen Fortsetzungsfeststellungsantrag umzustellen hätte, um der Abweisung der Klage – als „derzeit“ unbegründet – zu entgehen. Solange die Baugenehmigungsbehörde den Bauantrag nicht bearbeiten muss, liegt ein zureichender Grund dafür vor, dass die beantragte Baugenehmigung noch nicht erlassen ist, und ist das Klageverfahren nach § 75 Satz 3 VwGO auszusetzen, wenn – wie hier – eine Untätigkeitsklage erhoben wurde und die Frist des § 75 Satz 2 VwGO abgelaufen ist. An einer inhaltlichen Entscheidung über den Verpflichtungsantrag ist das Gericht gehindert, weil die Aussetzung des Verfahrens nicht in seinem Ermessen steht, sondern zwingend geboten ist.
Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 30. Juni 2011 – 4 C 10.10
- vgl. BVerwG, Urteile vom 24.01.1992 – 7 C 24.91, BVerwGE 89, 354, 355, vom 29.04.1992 – 4 C 29.90, Buchholz 310 § 113 VwGO Nr. 247 S. 90 und vom 19.09. 2002 – 4 C 13.01, BVerwGE 117, 50, 51[↩]
- BVerwG, Urteil vom 27.03.1998 – 4 C 14.96, BVerwGE 106, 295[↩]
- vgl. BVerwG, Urteil vom 29.04.1992 a.a.O.[↩]
- BVerwG, Beschluss vom 15.08.1988 – 4 B 89.88, NVwZ 1989, 48[↩]
- BVerwG, Urteile vom 24.07.1980 – 3 C 120.79, BVerwGE 60, 328, 332 f. und vom 24.10.1980 – 4 C 3.78, BVerwGE 61, 128, 134; Beschluss vom 15.08.1988 a.a.O.; Schmidt: in: Eyermann, VwGO, 13. Aufl. 2010, § 113 Rn. 77[↩]
- BVerwG, Urteil vom 10.12.1971 – 4 C 32.69 – BRS 24 Nr. 148 S. 224[↩]
- BVerwG, Urteil vom 16.10.1987 – 4 C 35.85 – BRS 47 Nr. 90 S. 236[↩]
- Rieger, in: Schrödter, BauGB, 7. Aufl., § 15 Rn. 12[↩]
- OVG NRW, Beschluss vom 26.01.2000 – 7 B 2023/99, NVwZ-RR 2001, 17; Stock, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, Band 2 Stand Januar 2011, § 15 Rn. 72; Hornmann, in: Spannowsky/Uechtritz, BauGB, § 15 Rn. 56; Lemmel, in: Berliner Kommentar zum BauGB, 3. Aufl., Band 1 Stand Dezember 2008, § 15 Rn. 21[↩]