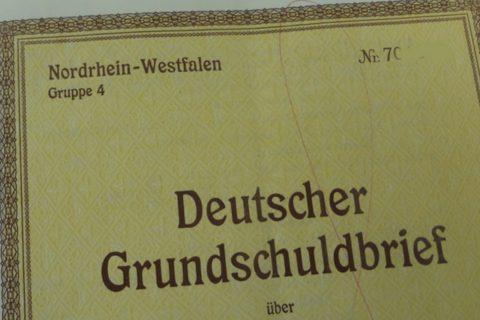Ein Beratungsvertrag kommt regelmäßig konkludent zustande, wenn im Zusammenhang mit der Anlage eines Geldbetrages tatsächlich eine Beratung stattfindet1. Tritt ein Anlageinteressent an ein Kreditinstitut oder der Anlageberater einer Bank an einen Kunden heran, um über die Anlage eines Geldbetrages beraten zu werden beziehungsweise zu beraten, so wird das darin liegende Angebot zum Abschluss eines Beratungsvertrages stillschweigend durch die Aufnahme des Beratungsgespräches angenommen2.

Danach ist für den Abschluss eines Anlageberatungsvertrages ohne Bedeutung, von welcher Partei – Kunde oder Bank – die Initiative ausgegangen ist. Entscheidend ist vielmehr, dass es zu Verhandlungen kommt, welche eine konkrete Anlageentscheidung zum Gegenstand haben3 und deren fachkundige Bewertung und Beurteilung durch die Bank als Grundlage für die Anlageentscheidung dienen soll.
Unter Anwendung der vorgenannten Grundsätze bleibt für die Annahme eines konkludent zustande gekommenen Beratungsvertrages dann kein Raum, wenn der Kunde der Bank gezielte Aufträge erteilt und sich die Tätigkeit der Bank auf deren Erledigung beschränkt. Denn in einem solchen Fall darf die Bank davon ausgehen, dass sich der Kunde über das von ihm angestrebte Anlagegeschäft bereits informiert hat und er insoweit nur noch der Beratung bedarf, als er dies ausdrücklich verlangt4.
Aus dem Beratungsvertrag ist die Bank zu einer anleger- und objektgerechten Beratung verpflichtet5. Inhalt und Umfang der Beratungspflichten hängen dabei von den Umständen des Einzelfalls ab. Maßgeblich sind einerseits der Wissensstand, die Risikobereitschaft und das Anlageziel des Kunden und andererseits die allgemeinen Risiken, wie etwa die Konjunkturlage und die Entwicklung des Kapitalmarktes, sowie die speziellen Risiken, die sich aus den Besonderheiten des Anlageobjekts ergeben6. In Bezug auf das Anlageobjekt hat sich die Beratung auf diejenigen Eigenschaften und Risiken zu beziehen, die für die jeweilige Anlageentscheidung wesentliche Bedeutung haben oder haben können. Während die Bank über diese Umstände richtig, sorgfältig, zeitnah, vollständig und für den Kunden verständlich zu unterrichten hat7, muss die Bewertung und Empfehlung des Anlageobjekts unter Berücksichtigung der genannten Gegebenheiten lediglich ex ante betrachtet vertretbar sein. Das Risiko, dass eine aufgrund anleger- und objektgerechter Beratung getroffene Anlageentscheidung sich im Nachhinein als falsch erweist, trägt der Anleger8.
Anlegergerechte Beratung
Im Rahmen der vom Anlageberater geschuldeten anlegergerechten Beratung müssen die persönlichen (wirtschaftlichen) Verhältnisse des Kunden berücksichtigt und insbesondere das Anlageziel, die Risikobereitschaft und der Wissensstand des Anlageinteressenten abgeklärt werden; die empfohlene Anlage muss unter Berücksichtigung des Anlageziels auf die persönlichen Verhältnisse des Kunden zugeschnitten sein9.
Allein der Umstand, dass eine Anlage der – ergänzenden – Altersversorgung dienen soll, rechtfertigt jedoch noch nicht den Schluss, die Empfehlung der Beteiligung an einem Fonds mit Totalverlustrisiko stelle keine anlegergerechte Beratung dar10.
Objektgerechte Beratung
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichthofes sind Anlageberater generell verpflichtet, im Rahmen der objektgerechten Beratung unaufgefordert über Vertriebsprovisionen Aufklärung zu geben, wenn diese eine Größenordnung von 15 % des von den Anlegern einzubringenden Kapitals überschreiten11.
Dem liegt die Erwägung zu Grunde, dass Vertriebsprovisionen solchen Umfangs Rückschlüsse auf eine geringere Werthaltigkeit und Rentabilität der Kapitalanlage eröffnen und dies wiederum einen für die Anlageentscheidung derart bedeutsamen Umstand darstellen kann, dass der Anlageinteressent hierüber informiert werden muss12.
Beratung und Anlageprospekt
Eine ordnungsgemäße Beratung kann durch Übergabe von Prospektmaterial erfolgen, sofern der Prospekt nach Form und Inhalt geeignet ist, die nötigen Informationen wahrheitsgemäß und verständlich zu vermitteln und er dem Anlageinteressenten so rechtzeitig vor dem Vertragsschluss übergeben wird, dass sein Inhalt noch zur Kenntnis genommen werden kann13.
Ob ein Prospekt unrichtig oder unvollständig ist, ist nicht allein anhand der wiedergegebenen Einzeltatsachen, sondern nach dem Gesamtbild zu beurteilen, das er nach einer sorgfältigen und eingehenden Lektüre von den Verhältnissen des Unternehmens vermittelt14. Einen rechtzeitig übergebenen Prospekt muss der Anleger im eigenen Interesse sorgfältig und eingehend durchlesen15. Wurde der Anleger von der Bank ordnungsgemäß mittels Übergabe eines fehlerfreien Prospektes aufgeklärt, nimmt er die Informationen jedoch nicht zur Kenntnis, geht das grundsätzlich zu seinen Lasten16.
Für die nicht erfolgte Übergabe trägt zwar der Anleger die Darlegungs- und Beweislast17. Eine anlageberatende Bank hat im Rahmen ihrer sekundären Darlegungslast die behauptete unterbliebene Übergabe des Prospektes jedoch substantiiert zu bestreiten und konkret darzulegen, wann, wo und wie die gebotene Beratung oder Aufklärung erfolgt ist, d.h. bei Beratung durch Prospektübergabe der Prospekt übergeben worden ist18.
Umfang des Schadensersatzes – entgangene Anlagezinsen
Der Schadensersatzanspruch wegen schuldhafter Verletzung des Beratungsvertrages umfasst nach § 252 Satz 1 BGB allerdings auch den entgangenen Gewinn. Dazu gehören grundsätzlich auch entgangene Anlagezinsen.
Der Anleger kann sich hierbei gemäß § 252 Satz 2 BGB auf die allgemeine Lebenserfahrung berufen, dass Eigenkapital ab einer gewissen Höhe erfahrungsgemäß nicht ungenutzt liegen bleibt, sondern zu einem allgemein üblichen Zinssatz angelegt wird19. Der Geschädigte trägt die Darlegungs- und Beweislast dafür, ob und in welcher Höhe ihm durch das schädigende Ereignis ein Gewinn entgangen ist20. § 252 Satz 2 BGB enthält für den Geschädigten lediglich eine die Regelung des § 287 ZPO ergänzende Darlegungs- und Beweiserleichterung. Der Geschädigte kann sich deshalb zwar auf die Behauptung und den Nachweis der Anknüpfungstatsachen beschränken, bei deren Vorliegen die in § 252 Satz 2 BGB geregelte Vermutung eingreift20.
Die Wahrscheinlichkeit einer Gewinnerzielung im Sinne von § 252 BGB aufgrund einer zeitnahen alternativen Investitionsentscheidung des Geschädigten und deren Umfang kann jedoch nur anhand seines Tatsachenvortrages dazu beurteilt werden, für welche konkrete Form der Kapitalanlage er sich ohne das schädigende Ereignis entschieden hätte20. Der Tatsachenvortrag des Anlegers, er hätte den Betrag „anderweitig sicher“ angelegt, hierzu reicht nicht aus.
Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 08.05.201221 muss ein geschädigter Anleger darlegen, welcher Gewinn nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erzielt worden wäre.
Oberlandesgericht Düsseldorf, Urteil vom 12. September 2014 – I -16 U 230/13
- BGH, Urteil vom 25.09.2007 – XI ZR 320/06, Rn. 12; BGH, Urteil vom 25.06.2002 – XI ZR 218/01, Rn. 38[↩]
- BGH, Urteil vom 25.09.2007 – XI ZR 320/06; BGH, Urteil vom 21.03.2006 – XI ZR 63/05; BGH, Urteil vom 09.05.2000 – XI ZR 159/99[↩]
- BGH, Urteil vom 06.07.1993 – XI ZR 12/93[↩]
- BGH, Urteil vom 19.05.1998 – XI ZR 216/97, Rn. 13; OLG Düsseldorf, Urteil vom 19.11.1999 – I-16 U 196/98, ZIP 1999, 2144 Rn. 82[↩]
- BGH Urteil vom 06.07.1993, XI ZR 12/93, BGHZ 123, 126, 128 f.[↩]
- BGH, Urteil vom 21.09.2011 – XI ZR 182/10, BGHZ 191, 119; BGH, Urteil vom 06.07.1993 – XI ZR 12/93, BGHZ 123, 126, 128 f.; Urteil vom 07.10.2008 – XI ZR 89/07, BGHZ 178, 149 Rn. 12; Urteil vom 09.05.2000 – XI ZR 159/99, WM 2000, 1441, 1442; BGH, Urteil vom 14.07.2009 – XI ZR 152/08, WM 2009, 1647 Rn. 49[↩]
- BGH, Urteil vom 21.09.2011 – XI ZR 182/10, BGHZ 191, 119 mit weiteren Nachweisen der Rechtsprechung[↩]
- BGH, Urteil vom 21.03.2006 – XI ZR 63/05, WM 2006, 851 Rn. 12, BGH, Urteil vom 14.07.2009 – XI ZR 152/08, WM 2009, 1647 Rn. 49; BGH, Urteil vom 27.10.2009 – XI ZR 337/08, WM 2009, 2303 Rn.19[↩]
- BGH, Urteil vom 24.04.2014 – III ZR 389/12; BGH, Urteil vom 06.12.2012 – III ZR 66/12, NJW-RR 2013, 221; BGH, Urteil vom 19.04.2007 – III ZR 75/06, NJW-RR 2007, 1271, 1272 Rn. 9; BGH, Urteil vom 06.07.1993 – XI ZR 12/93, BGHZ 123, 126, 128 f; BGH, Urteil vom 27.10.2009, – XI ZR 337/08, NJW-RR 2010, 115, 117 Rn. 25[↩]
- vgl. BGH Urteil vom 24.04.2014 – III ZR 389/12; BGH, Urteil vom 06.12.2012 – III ZR 66/12[↩]
- grundlegend BGH, Urteil vom 12.02.2004 – III ZR 359/02; zuletzt BGH, Urteil vom 18.04.2013 – III ZR 225/12; BGH, Urteil vom 10.11.2011 – III ZR 245/10; BGH, Urteil vom 05.05.2011 – III ZR 84/10; BGH Urteil vom 03.03.2011 – III ZR 170/10[↩]
- BGH Urteil vom 03.03.2011 – III ZR 170/10; BGH Urteil vom 12.02.2004 – III ZR 359/02[↩]
- st. Rspr. zuletzt BGH, Urteil vom 24.04.2014 – III ZR 389/12[↩]
- BGH, Urteil vom 14.06.2007 – III ZR 125/06[↩]
- BGH, Urteil vom 26.02.2013 – XI ZR 345/10[↩]
- BGH a.a.O.[↩]
- BGH, Urteil vom 06.12.2012 – III ZR 66/12, m.w.N.[↩]
- vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 22.12.2011 – I-6 U 201/10; OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 22.01.2014 – 17 U 106/12[↩]
- st. Rspr. zuletzt BGH, Urteil vom 28.05.2013 – XI ZR 148/11; BGH, Urteil vom 26.02.2013 – XI 183/11[↩]
- zuletzt BGH, Urteil vom 28.05.2013 – XI ZR 148/11; BGH, Urteil vom 26.02.2013 – XI 183/11[↩][↩][↩]
- BGH, Urteil vom 08.05.2012 – XI ZR 262/10[↩]