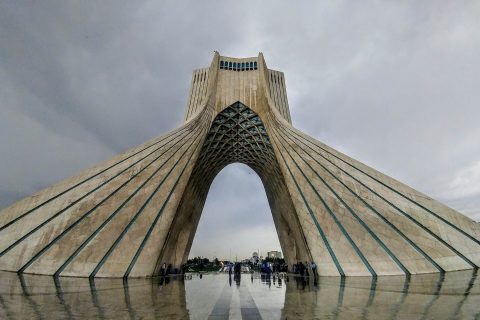Der Bundesgerichtshof musste in einem aktuellen Urteil Stellung nehmen zur Haftung des in einem Kapitalanlagemodell eingesetzten Mittelverwendungskontrolleurs, der es unterlässt, vor Aufnahme der Tätigkeit der Fondsgesellschaft sicherzustellen, dass die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Verwendungskontrolle vorliegen.

Umfang der Kontrollpflichten
Der Bundesgerichtshof hat bereits im Jahr 20031 einen Mittelverwendungskontrolleur gegenüber den künftigen Anlegern schon vor Abschluss des Vertrages und ohne konkreten Anlass für verpflichtet gehalten, sicherzustellen, dass sämtliche Anlagegelder von Anfang an in seine (Mit-)Verfügungsgewalt gelangten, da er ansonsten nicht in der Lage war, deren Verwendung zu den vertraglich vorgesehenen Zwecken auftragsgerecht zu gewährleisten. Hierzu gehörte es, das Anlagemodell darauf zu untersuchen, ob ihm Anlagegelder vorenthalten und damit seiner Mittelverwendungskontrolle entzogen werden könnten. Diese Entscheidung bezieht sich zwar auf einen Mittelverwendungskontrolleur, der zugleich Treuhandkommanditist war. Einen solchen treffen gegenüber dem bloßen Mittelverwendungskontrolleur weitergehende Prüfungs-, Kontroll- und Hinweispflichten in Bezug auf alle wesentlichen Umstände, die für die zu übernehmende Beteiligung von Bedeutung sind2. Hinsichtlich der Pflichten, die aus der Übernahme der Mittelverwendungskontrolle folgen, kann für den Mittelverwendungskontrolleur nach dem Zweck des Mittelverwendungskontrollvertrags jedoch nichts anderes gelten.
Die von ihm übernommene Funktion bestand darin, die Anleger davor zu schützen, dass die geschäftsführenden Gesellschafter Zahlungen von dem Sonderkonto vornehmen, ohne dass die in § 1 Abs. 3 MVKV genannten Voraussetzungen vorliegen. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, musste er sicherstellen, dass er die ihm obliegende Kontrolle über den Mittelabfluss auch tatsächlich ausüben konnte. Da ein Konto, über das nur unter seiner Mitwirkung verfügt werden konnte, eine zentrale Bedingung des Kontrollvertrages darstellte und Voraussetzung für die effektive Verwirklichung seines Schutzzwecks war, durfte er nicht ohne eigene Vergewisserung darauf vertrauen, dass die für das Sonderkonto bestehenden Zeichnungsbefugnisse den Anforderungen des Kontrollvertrages entsprachen. Dabei konnte er schon nicht ausschließen, insoweit von den Geschäftsführern der Fondsgesellschaft mit einer „dreisten Lüge bedient“ zu werden. Jedenfalls aber musste er gewärtigen, dass es bei der Einrichtung des Sonderkontos infolge von Unachtsamkeiten oder Irrtümern auf Seiten der Bank oder der Fondsgesellschaft zu Fehlern bei der Einräumung der Zeichnungsrechte kommen konnte.
Hiernach oblag ihm die Überprüfung, ob die geschäftsführenden Gesellschafter nur mit ihm gemeinschaftlich für das Sonderkonto zeichnungsberechtigt waren.
Diese Prüfungspflicht bestand zu dem Zeitpunkt, ab dem die Anlage „einsatzbereit“ war. Die Mittelverwendungskontrolle musste naturgemäß sichergestellt sein, bevor die Anleger Beteiligungen zeichneten und Zahlungen auf ihre Einlagen leisteten1. Bereits hieraus folgt, dass den Beklagten vorvertragliche Pflichten gegenüber den (künftigen) Anlegern trafen. Überdies ist zu berücksichtigen, dass der Mittelverwendungskontrollvertrag, wie der bestellte Kontrolleur wusste, im Emissionsprospekt als ein die Sicherheit und Seriosität der Anlage suggerierendes, werbewirksames Merkmal des Fonds hervorgehoben wurde. Dementsprechend vertrauten nach der gebotenen typisierenden Betrachtungsweise die potentiellen Anleger, die sich für den Zinsfonds interessierten, darauf, dass der Beklagte die Mittelverwendungskontrolle gemäß den Vertragsbedingungen ins Werk gesetzt hatte, § 311 Abs. 2 BGB3.
Haftung gegenüber den (späteren) Anlegern
Den (späteren) Anlagern gegenüber beschränkten sich indessen die Pflichten des Mittelverwendungskontrolleurs nicht auf die bloße Überprüfung, ob die Zeichnungsbefugnisse für das Sonderkonto den Anforderungen des Mittelverwendungskontrollvertrags entsprachen, und darauf, der Fondsgesellschaft gegenüber auf die Beseitigung der Mängel hinzuwirken.
In dem jetzt vom BGH entschiedenen Rechtsstreit war die Gesellschaft zum Zeitpunkt des Fondsbeitritts der Anleger bereits geraume Zeit tätig, ohne dass der Kontrolleur seinen Verpflichtungen nachgekommen war. Er konnte deshalb nicht ausschließen, dass es bereits vor dem Beitritt der Kläger dem Mittelverwendungskontrollvertrag widersprechende Auszahlungen von dem Sonderkonto gegeben hatte, durch die das Gesellschaftsvermögen – auch zum Nachteil der künftig beitretenden Gesellschafter – fortwirkend vermindert worden war. In dieser Situation hätte der Beklagte seinen vorvertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Beitrittsinteressenten nicht allein dadurch genügt, für eine ordnungsgemäße Mittelverwendungskontrolle in der Zukunft Sorge zu tragen. Da eine zweckwidrige Minderung des Gesellschaftsvermögens bereits eingetreten sein konnte, hätte er nach Aufnahme der Tätigkeit des Fonds vielmehr unverzüglich zusätzlich darauf hinweisen müssen, dass die im Prospekt werbend herausgestellte Mittelverwendungskontrolle bislang nicht stattgefunden hatte. Er hätte deshalb auf eine Änderung des Prospekts drängen müssen und Anleger, die vor einer derartigen Prospektänderung ihr Interesse an einer Beteiligung bekundeten, in geeigneter anderer Weise unterrichten müssen4.
Der Bundesgerichtshof verkennt dabei nach eigenem Bekunden nicht, dass es für den Kontrolleur – anders als in den Fällen, in denen der Treuhandkommanditist zum Mittelverwendungskontrolleur bestimmt ist und daher zwangsläufig in unmittelbaren Kontakt zu den beitrittswilligen Anlegern tritt -, durchaus mit Mühen verbunden gewesen wäre, die Anlageinteressenten rechtzeitig vor Tätigung der Anlage zu informieren. Der BGH ging jedoch in dem konkreten Fall davon aus, dass ihm zumutbare und hinreichend erfolgversprechende Mittel zur Verfügung standen. So hätte er insbesondere den Vertrieb und notfalls die Fachpresse über die unterbliebene Mittelverwendungskontrolle informieren können. Es wird, so der BGH weiter, Sache des Kontrolleurs sein, darzutun und gegebenenfalls zu beweisen, dass ihm die Erfüllung dieser Informationspflichten nicht möglich war.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 19. November 2009 – III ZR 109/08
- BGH, Urteil vom 24.07.2003 – III ZR 390/02, NJW-RR 2003, 1342, 1343[↩][↩]
- z.B.: BGHZ 84, 141, 144 f; BGH, Urteile vom 12.02.2009 – III ZR 90/08, NJW-RR 2009, 613, 614 Rn. 8; und vom 29.05.2008 – III ZR 59/07, NJW-RR 2008, 1129, 1130 Rn. 8, jeweils m.w.N.[↩]
- vgl. auch BGHZ 145, 187, 197[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 24. Juli 2003 aaO[↩]