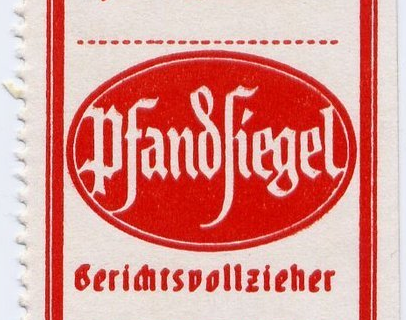Rückständige Unterhaltsforderungen können als Forderungen aus vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung zur Insolvenztabelle festgestellt werden.

Die Unterhaltsgläubiger haben einen Anspruch darauf, sämtliche Unterhaltsrückstände mit dem Attribut zur Insolvenztabelle feststellen zu lassen, dass diese aus vorsätzlich unerlaubten Handlungen stammen, § 170 Abs. 1 StGB i.V.m. § 823 Abs. 2 BGB. Nachdem der Insolvenzschuldner Widerspruch gegen die Anmeldung der Forderungen als aus vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlungen eingelegt hat, dürfen die Insolvenzgläubiger Klage auf Feststellung dieses Rechtsgrundes erheben, §§ 184 Abs. 1, 302 Nr. 1 InsO (analog1). Dies ist auch und gerade bei Unterhaltsansprüchen möglich2.
Unterhaltsforderungen, auch Rückstände hierauf, können auf einer unerlaubten Handlung beruhen, wenn und soweit sie unter Verstoß gegen § 170 StGB aufgelaufen sind. § 170 StGB ist ein Schutzgesetz i.S.v. § 823 Abs. 2 BGB, weshalb eine deliktische Qualifikation möglich ist3.
Das Schutzgesetz in Form des § 170 Abs. 1 StGB ist verletzt, wenn der Lebensbedarf eines gesetzlich zum Unterhalt Berechtigten gefährdet ist oder ohne die Hilfe anderer gefährdet wäre; dies ist vorliegend durchgängig der Fall.
Der Insolvenzschuldner hat sich im hier entschiedenen Fall nach Ansicht des Amtsgerichts Villingen-Schwenningen seinen gesetzlichen Unterhaltspflichten entzogen, da er trotz durchgängig vorhandener unterhaltsrechtlicher Leistungsfähigkeit den Unterhalt nicht vollständig gewährte. Dass für die Zeit von November 1998 bis März 2003 eine fiktive Zurechnung von Einkommen in der zuvor und auch danach bezogenen Höhe an Gehaltszahlungen erfolgt ist insoweit irrelevant. Auch ein fiktiv zugerechnetes Einkommen ist ein gesetzlich geschuldeter Unterhalt, der in objektiver Hinsicht nicht gewährt wurde. Der objektive Tatbestand ist daher auch und gerade dann erfüllt, wenn der Unterhaltsverpflichtete – hier der Insolvenzschuldner – sein Arbeitsverhältnis (unterhaltsrechtlich vorwerfbar) aufgibt4. Dies ist der Fall.
Selbst dann, wenn der eheliche Plan hierzu, sich selbstständig zu machen, existiert haben sollte, durfte der Insolvenzschuldner ihn – zumal auch noch nach der Scheidung erfolgt – gegenüber den Kindern zu keinem Zeitpunkt, aber auch gegenüber der Ex-Ehefrau nicht mehr umsetzen, ohne sich dem Vorwurf leichtfertigen Verhaltens in unterhaltsrechtlicher Hinsicht auszusetzen. In Anbetracht der Trennung bei Vorhandensein zweier minderjähriger Kinder, die auf absehbare Zeit unterhaltsbedürftig erschienen und auch gewesen sind, musste der Insolvenzschuldner bereits aus diesem Grund auch gegenüber der Ex-Ehefrau spätestens ab Anhängigkeit des Scheidungsverfahrens den ehelichen Plan als gescheitert betrachten und unter durfte ihn unterhaltsrechtlich nicht mehr verwirklichen.
Der objektive Tatbestand von § 170 StGB ist daher selbst in den Zeiten verletzt, in denen der Insolvenzschuldner möglicherweise kein ausreichendes Einkommen erzielte, dieses jedoch unterhaltsrechtlich fiktiv zugerechnet wird.
Hinsichtlich der objektiv erforderlichen Gefährdung ist nicht erforderlich, dass auch eine tatsächliche Beeinträchtigung eingetreten ist.
Nachdem die Kinder kein eigenes Vermögen hatten und sie nur durch die Ex-Ehefrau und die Unterhaltsvorschusskasse ernährt und versorgt werden konnten, ist insoweit der objektive Tatbestand ohne weiteres verwirklicht. Die Kinder waren offensichtlich nicht in der Lage, sich selbst zu versorgen; die Versorgung durch die Unterhaltsvorschusskasse ist ohne weiteres tatbestandlich, § 170 Abs. 1, 2. Alt. StGB, die Versorgung durch die Kindesmutter (die Ex-Ehefrau) beseitigt den objektiven Tatbestand nach § 170 Abs. 1, 1. Alt. StGB gerade nicht.
Was die Ex-Ehefrau angeht ist die erforderliche konkrete Gefährdung schon dann verwirklicht, wenn und soweit vorliegend die Ex-Ehefrau notgedrungen selbst den Unterhalt durch eine Erwerbstätigkeit bestreitet, die ihr nur durch unzumutbare Anstrengungen möglich war5.
Soweit die Ex-Ehefrau daher ihren Bedarf durch Sozialhilfe deckte, ist § 170 Abs. 1, 2. Alt. StGB verwirklicht; soweit sie im Zeitraum bis zur Heirat im Herbst 2002, als das jüngste Kind gerade sieben Jahre alt geworden war, dennoch ihren Lebensbedarf teilweise durch eigene Erwerbstätigkeit gedeckt hat, ändert dies nichts am Vorliegen des objektiven Straftatbestandes, da die Ex-Ehefrau in diesem Zeitraum unterhaltsrechtlich nicht verpflichtet war, zu arbeiten, die aufgenommene Arbeit daher überobligatorisch und unzumutbar war.
Dass die Inanspruchnahme öffentlicher Hilfen und die Ausübung einer unzumutbaren Erwerbstätigkeit alleine dem Umstand geschuldet waren, dass der Insolvenzschuldner seine titulierten Unterhaltsverpflichtungen nicht erfüllt hat, ist offenkundig.
Soweit der Insolvenzschuldner behauptet, er habe mit der Aufgabe seiner abhängigen Beschäftigung und dem Übergang in die Selbständigkeit einen ehelichen Plan verwirklicht, waren ihm alle Tatumstände bekannt, woraus sich die unterhaltsrechtliche Unzulässigkeit im Herbst 1998 – zumal nach der Scheidung – ergab; insoweit ist der Insolvenzschuldner auch keinem erheblichen Tatbestandsirrtum erlegen.
Die Angriffe des Insolvenzschuldnern gegen die Berechtigung der titulierten Unterhaltsansprüche gehen im vorliegenden Verfahren schon deswegen fehl, weil den Feststellungen der Forderungen zur Insolvenztabelle dem Grunde nach durch den Insolvenzschuldnern nicht widersprochen wurde, sondern lediglich der Rechtsgrund als aus einer vorsätzlichen unerlaubten Handlung stammend.
Der objektive Tatbestand von § 170 Abs. 1 StGB ist daher hinsichtlich aller Unterhaltsrückstände, auch denen der Ex-Ehefrau, erfüllt.
In subjektiver Hinsicht ist bedingter Vorsatz ausreichend6. Nachdem der Klägervertreter diese Unterhaltsansprüche aller Kläger bereits ab Oktober 1997 hartnäckig verfolgte, unter dem 17.10.1997 z.B. bereits Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung über Kindes- und Trennungsunterhalt beantragte und auch erwirkte, umfangreich Kontakt mit Arbeitgebern, deutschen und ausländischen Behörden betrieb und zahlreiche Urteile gegen den Insolvenzschuldnern erwirkte, liegt die Verwirklichung des subjektiven Tatbestandes durch den Insolvenzschuldnern auf der Hand. Der Insolvenzschuldner wurde auch zigfach von Sozialhilfeträgern angeschrieben, diese bereits beginnend mit Herbst 1997 durch das Kreissozialamt des Landratsamts S.; im Dezember 1997 war der Kontakt des Kreissozialamts mit dem Insolvenzschuldnern wegen der Sozialhilfebedürftigkeit aller Kläger bereits so weit gediehen, dass die Ex-Ehefrau bereits mit der gerichtlichen Durchsetzung der Ansprüche gegen den Insolvenzschuldnern wegen des gesetzlichen Forderungsübergangs nach § 91 Abs. 1 Bundessozialhilfegesetz beauftragt worden war. Damit wusste der Insolvenzschuldner, dass die Kläger auf Sozialhilfe angewiesen waren. Auch waren ihm alle Tatumstände, insbesondere das Alter der Kinder bekannt, woraus sich die fehlende Erwerbsobliegenheit der Ex-Ehefrau ergab.
Der subjektive Straftatbestand des § 170 Abs. 1 StGB war deshalb ebenfalls erfüllt.
Die erforderliche Rechtswidrigkeit wird durch die Schutzgesetzverletzung indiziert7. Vortrag des Insolvenzschuldnern, der gegen die Annahme der Rechtswidrigkeit spricht, ist im Übrigen nicht ersichtlich; der ihn treffenden Beweislast hat der Insolvenzschuldner nicht genügt8.
Auch das Verschulden hinsichtlich der Verletzung des Schutzgesetzes ist gegeben. Umstände, die geeignet sind, die Annahme des Verschuldens am Verstoß gegen das Schutzgesetz auszuräumen, hat der Insolvenzschuldner nicht dargelegt und bewiesen9.
Die unstreitigen Einkommensverhältnisse des Insolvenzschuldnern zwischen Oktober 1997 und März 2009, die abgesehen von November 1998 bis März 2003 ausreichend zur Erfüllung aller Unterhaltsverpflichtungen waren, zeigen, dass der Insolvenzschuldner trotz der Möglichkeit und zahlreicher Zahlungsaufforderungen nicht gewillt war, den titulierten Unterhalt für die Kläger zu entrichten. Dies lässt in Ermangelung erheblichen Vortrags des Insolvenzschuldnern nur den Schluss zu, dass dies vorsätzlich und damit schuldhaft war. Pfändungen anderer Gläubiger hat der Insolvenzschuldner zwar behauptet, jedoch nicht substantiiert dargelegt oder gar Beweis angetreten.
In Kenntnis aller erforderlichen Tatumstände hat der Insolvenzschuldner auch nach der Scheidung seine abhängige Beschäftigung aufgegeben, die ihn zur Zahlung der titulierten Unterhaltsansprüche, die auf den Grundlagen des zuvor erzielten Einkommens erstellt wurden, befähigt hätte. Dieser Verstoß war offenkundig ebenfalls schuldhaft; geeignete Umstände, die die Annahme des Verschuldens ausgeräumt hätten, hat der Insolvenzschuldner ebenfalls nicht dargelegt und bewiesen.
Somit steht fest, dass alle Unterhaltsrückstände der Kläger unter Verletzung von § 170 Abs. 1, 1. Alt., 2. Alt. StGB aufgelaufen sind. Die Forderungen stammen daher aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung und können mit diesem Attribut nach § 184 Abs. 1 InsO (analog) zur Insolvenztabelle festgestellt werden, um einer Restschuldbefreiung nach den §§ 286, 301, 302 Nr. 1 InsO zu verhindern.
Amtsgericht Villingen-Schwenningen, Urteil vom 24. Juni 2011 – 2 F 328/09
- vgl. BGH, Urteil vom 18.01.2007, Az. IX ZR 176/05 = NJW-RR 2007, 991[↩]
- vgl. OLG Celle, Beschluss vom 23.02.2009, Az. 7 W 2/09, BeckRS 2009, 08698[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 11.05.2010, Az. IX ZB 163/09 = NJW 2010, 2353; BGH, Urteil vom 02.07.1974, Az. VI ZR 56/73 = NJW 1974, 1868 zur Vorgängervorschrift § 170b StGB; Palandt, 40. Aufl.2011, § 823, Rn. 69[↩]
- vgl. Schönke/Schröder, 28. Aufl.2010, § 170, Rn. 27 m.w.N.[↩]
- vgl. OLG München, Entscheidung vom 28.06.1961, Az. 1 St 183/61 = FamRZ 1962, 120[↩]
- h.M., so bereits BGHSt 14, 168[↩]
- BGH NJW 1993, 1580[↩]
- vgl. BGH NJW 2008, 571[↩]
- BGH, Urteil vom 13.12.1994, Az. III ZR 20/83, NJW 1985, 1774, 1775, unter IV2a[↩]