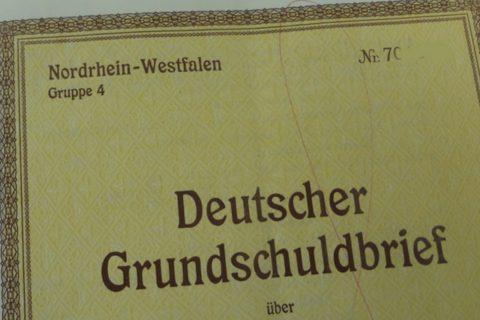Einem Anleger muss für seine Beitrittsentscheidung ein richtiges Bild über das Beteiligungsobjekt vermittelt werden; das heißt, er muss über alle Umstände, die für seine Anlageentscheidung von wesentlicher Bedeutung sind oder sein können, verständlich und vollständig aufgeklärt werden, wozu auch eine Aufklärung über Umstände gehört, die den Vertragszweck vereiteln können1.

In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist anerkannt, dass es als Mittel der Aufklärung genügen kann, wenn dem Interessenten statt einer mündlichen Aufklärung ein Prospekt über die Kapitalanlage überreicht wird, sofern dieser nach Form und Inhalt geeignet ist, die nötigen Informationen wahrheitsgemäß und vollständig zu vermitteln, und er dem Anlageinteressenten so rechtzeitig vor dem Vertragsschluss übergeben wird, dass sein Inhalt noch zur Kenntnis genommen werden kann2.
Für die Beurteilung, ob ein Prospekt unrichtig oder unvollständig ist, ist nicht isoliert auf eine bestimmte Formulierung, sondern auf das Gesamtbild abzustellen, das er dem Anleger unter Berücksichtigung der von ihm zu fordernden sorgfältigen und eingehenden Lektüre vermittelt3.
Die Anforderungen an diese Aufklärungspflicht dürfen jedoch nicht überspannt werden.
Für die Frage, ob ein Emissionsprospekt unrichtig oder unvollständig ist, kommt es nicht allein auf die darin wiedergegebenen Einzeltatsachen, sondern wesentlich auch darauf an, welches Gesamtbild er von den Verhältnissen des Unternehmens vermittelt4. Dabei ist auf den Empfängerhorizont abzustellen, wobei nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auf die Kenntnisse und Erfahrungen eines durchschnittlichen Anlegers abzustellen ist, der als Adressat des Prospekts in Betracht kommt und der den Prospekt sorgfältig und eingehend gelesen hat5. Der Bundesgerichtshof kann die Auslegung uneingeschränkt selbst vornehmen, weil der Beteiligungsprospekt über den Bezirk des Berufungsgerichts hinaus verwendet wurde und daher ein Bedürfnis nach einer einheitlichen Auslegung besteht6.
Der Beteiligungsprospekt musste keinen Hinweis auf den teilweisen Ausfall der Mittelverwendungskontrolle in einem Vorgängerfonds der Serie enthalten.
Das allgemeine (abstrakte) Risiko, dass die Verwirklichung des Anlagekonzepts bei Pflichtwidrigkeiten der Personen, in deren Händen die Geschicke der Anlagegesellschaft liegen, gefährdet ist, kann als dem Anleger bekannt vorausgesetzt werden und bedarf grundsätzlich keiner besonderen Aufklärung. Pflichtverletzungen sind regelmäßig kein spezifisches Risiko der Kapitalanlage. Anders kann es liegen, wenn bestimmte Pflichtverletzungen aus strukturellen Gründen sehr naheliegend sind7. Davon abgesehen, dass danach nur ein Hinweis auf ein Risiko des streitgegenständlichen Fonds erforderlich wäre, nicht aber ein Hinweis auf ein pflichtwidriges Verhalten der Komplementärin in einem Vorgängerfonds, war das Vorliegen solcher strukturellen Gründe bei dem Fondskonzept der hier streitgegenständlichen Fondsgesellschaft (Publikumspersonengesellschaft) nicht ersichtlich. Allein die angenommene Möglichkeit der Umgehung der Mittelverwendungskontrolle begründet keine Aufklärungspflicht.
Der Umstand, dass die Komplementärin der Publikumskommanditgesellschaft in dem von der Konzeption ähnlichen Vorgängerfonds über 11.000.000 US$ für die Produktion eines Films ohne Mittelverwendungskontrolle durch die damals gleichfalls hierfür zuständige Treuhandkommanditistin verwendet hat, dass also die handelnden Personen identisch sind, erforderte unter dem Gesichtspunkt einer aus strukturellen Gründen sehr naheliegenden Pflichtverletzung keinen Hinweis auf diesen Vorgang. Die Umgehung der Mittelverwendungskontrolle im Vorgängerfonds wirkte sich auf die Struktur des Nachfolgefonds nicht aus. Das Berufungsgericht hat auch nicht festgestellt, dass es sich bei der fehlenden Mittelverwendungskontrolle in dem Vorgängerfonds bereits um eine aus strukturellen Gründen sehr naheliegende Pflichtverletzung gehandelt hat, sodass aus der früheren Pflichtverletzung keine Schlüsse auf eine erneute aus strukturellen Gründen sehr naheliegende Pflichtverletzung gezogen werden kann. Letztlich ergibt sich daraus, dass wieder diejenigen Personen handeln, die bereits einmal Gelder ohne Mittelverwendungskontrolle investiert haben, ohne zusätzliche Anhaltspunkte keine strukturelle Wiederholungsgefahr.
Eine Aufklärungspflicht lösst sich auch nicht unter dem Gesichtspunkt einer im Prospekt beworbenen Vertrauenswürdigkeit der hinter dem Fondskonzept stehenden Geschäftsführung bejahen. Aus dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 09.07.20138 ergibt sich nichts anderes. Dort hat der Bundesgerichtshof eine Aufklärungspflicht über Vorstrafen der mit der Verwaltung des Vermögens einer Anlagegesellschaft betrauten Person jedenfalls dann bejaht, wenn die abgeurteilten Straftaten nach Art und Schwere geeignet sind, ein Vertrauen der Anleger in die Zuverlässigkeit der betreffenden Person zu erschüttern. Der zweckentsprechenden Verwendung von Geldern für die Produktion eines Films lediglich unter einmaliger Außerachtlassung der gesellschaftsinternen Verwendungskontrolle bei einem Vorgängerfonds kommt eine solche vertrauenserschütternde Eignung nicht zu.
Die Prospektangaben genügen im Hinblick auf die Gefahr der Nichtanerkennung des steuerlichen Konzepts den Anforderungen an eine hinreichende Aufklärung der Anleger. Der Prospekt musste entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht auf die Gefahr hinweisen, dass das dort beschriebene Fremdfinanzierungskonzept mangels Vorliegens der in § 15a Abs. 1 Satz 2 und 3 EStG normierten Voraussetzungen des sogenannten erweiterten Verlustausgleichs von vornherein steuerrechtlich nicht anerkannt werde.
Der Prospekt hat sachlich richtig und vollständig über die mit einem Beitritt verbundenen Risiken aufzuklären. Dies gilt insbesondere auch für die Risiken der steuerlichen Anerkennungsfähigkeit des konkreten Anlagemodells9. Es muss aber nur über solche Risiken aufgeklärt werden, mit deren Verwirklichung ernsthaft zu rechnen ist oder die jedenfalls nicht nur ganz entfernt liegen10. Es besteht keine allgemeine Pflicht darauf hinzuweisen, dass die Konzeption eines Fonds in steuerlicher Hinsicht „neu“ ist und von der Finanzverwaltung bislang nicht abschließend überprüft bzw. in der finanzgerichtlichen Rechtsprechung nicht geklärt ist. Es genügt im Regelfall der allgemeine Hinweis, dass die Beurteilung der Finanzverwaltung von der steuerrechtlichen Beurteilung im Prospekt abweichen kann und sich hieraus für den Anleger das Risiko ergeben kann, dass die prospektierten steuerlichen Folgen nicht eintreten. Eine weitergehende Hinweispflicht besteht nur im Einzelfall, beispielsweise, wenn nach den konkreten Umständen eine klarstellende Abgrenzung zu ähnlichen, in ihrer steuerlichen Behandlung geklärten Konzeptionen geboten ist11.
Hieran gemessen lässt sich der vom Berufungsgericht angenommene Prospektfehler nicht bejahen. Der von der Rechtsprechung geforderte allgemeine Hinweis ist vorhanden. Konkrete Umstände, die eine weitergehende Hinweispflicht gebieten, insbesondere die Notwendigkeit einer klarstellenden Abgrenzung zu ähnlichen, in ihrer steuerlichen Behandlung geklärten Konzeptionen, sind nicht festgestellt.
Die Verlustabzugsbegrenzung des § 15a EStG und dessen Ausnahmen werden ausführlich im Prospekt dargestellt und erläutert. Im Ergebnis gewähre § 15a Abs. 1 Satz 2, 3 EStG für die Direktkommanditisten des Filmfonds, die den Gläubigern der Kommanditgesellschaft gemäß § 171 Abs. 1 HGB (aus überschießender Außenhaftung) hafteten, eine erweiterte Abzugsmöglichkeit für Verluste. Es könnten Verluste in Höhe der Differenz zwischen der im Handelsregister eingetragenen höheren Hafteinlage zur tatsächlich geleisteten Teileinzahlung auf die Pflichteinlage des Kommanditisten abgezogen werden, wenn die Kommanditisten im Handelsregister eingetragen seien, das Bestehen der Haftung nachgewiesen werde und die Vermögensminderung des Kommanditisten nicht durch Vertrag ausgeschlossen oder unwahrscheinlich sei. Diese Darstellung wird vom Berufungsgericht zu Recht nicht beanstandet.
Der Prospekt weist weiter darauf hin, dass das Steuerkonzept sorgfältig geprüft und auf das geltende Steuerrecht und die bekannte bisherige Verfahrenspraxis der Finanzverwaltung abgestimmt sei. Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, dass diese Aussage unzutreffend war. Dann genügt aber der vorhandene und für den durchschnittlichen Anleger, der den Prospekt sorgfältig und eingehend gelesen hat, verständliche Hinweis, es bestehe grundsätzlich das Risiko, dass die Finanzverwaltung eine andere Auffassung als die in der Prospektdarstellung angenommene vertrete. Ebenso könnten Änderungen der Gesetzeslage eintreten oder deren Handhabung durch die Finanzverwaltung nachteilige Ergebnisse hervorrufen.
Der Prospekt musste auch noch darauf hinweisen, dass die inhaltliche Bestimmung des Tatbestandsmerkmals des in § 15a Abs. 1 Satz 2 und 3 EStG normierten erweiterten Verlustausgleichs „eine Vermögensminderung auf Grund der Haftung … nach Art und Weise des Geschäftsbetriebs unwahrscheinlich ist“ seit jeher auf erhebliche Schwierigkeiten stoße. Der dem beitretenden Kommanditisten gegenüber Aufklärungspflichtige schuldet keine allgemeine, sämtliche steuerlichen Aspekte der Anlage umfassende Beratung. Darauf, dass sich die steuerliche Darstellung des Beteiligungsangebots auf die Wiedergabe ausgewählter Fragestellungen beschränkt, ohne Aufschluss über deren jeweilige Herleitung oder angrenzende bzw. ergänzende steuerliche Erwägungen zu vermitteln, weist der Prospekt ausdrücklich hin.
Im vorliegenden Fall wird einem durchschnittlichen Anleger, der den Prospekt eingehend und sorgfältig gelesen hat, das Totalverlustrisiko hinreichend deutlich vor Augen gehalten. Insoweit enthält der Prospekt keine Mängel, insbesondere wird nach dem vermittelten Gesamteindruck das Risiko eines Totalverlusts nicht in unzulässiger Weise verharmlost. Dies gilt auch dann, wenn man berücksichtigt, dass anders als bei einem Immobilienfonds, bei dem mit dem Immobilienvermögen der Investition ein Sachwert gegenübersteht, der in aller Regel erhalten bleibt, so dass das Risiko eines vollständigen Kapitalverlusts gering ist, bei einem Filmfonds ein Misserfolg der Produktion unmittelbar einen entsprechenden Verlust des eingebrachten Kapitals nach sich ziehen kann12.
An verschiedenen Stellen im Prospekt wird ausgeführt, dass es sich um eine echte unternehmerische Beteiligung mit den damit einhergehenden Risiken handelt. Das vom Berufungsgericht angeführte wirtschaftliche Hauptrisiko einer Filmproduktion, die Vorstellungen möglicher Verwertungspartner oder den Geschmack des Publikums nicht zu treffen13, wird ausdrücklich beschrieben. Auf die bei der Verwirklichung unternehmerischer Risiken bestehende und bei einer unternehmerischen Beteiligung in der Natur der Sache liegende14 Gefahr eines Totalverlusts wird an verschiedenen Stellen hingewiesen. Fehlerhafte Investitionsentscheidungen sowie die Unwirksamkeit von Sicherungsmaßnahmen, so der Prospekt, könnten zu negativen Ergebnissen und im Extremfall zum Verlust des gesamten Kommanditkapitals führen. Diese deutliche Aussage wird durch den Zusatz „im Extremfall“ nicht entwertet. An anderer Stelle wird nach der Darstellung verschiedener Risikoursachen ausgeführt, dass bei Eintritt kumulierter Risiken ein Totalverlustrisiko nicht gänzlich auszuschließen sei. Der sonach vermittelte Gesamteindruck der Möglichkeit eines Totalverlusts wird entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts durch den Hinweis auf den Eintritt mehrerer Risikoumstände nicht auf eine nicht fassbare geringe Wahrscheinlichkeit zurückgeführt. Es wird lediglich der nach der allgemeinen Lebenserfahrung zutreffende Umstand zum Ausdruck gebracht, dass die Insolvenz einer Fondsgesellschaft und der damit einhergehende mögliche Totalverlust des Anlagekapitals in der Regel mehr als eine Ursache haben.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 9. Mai 2017 – II ZR 344/15
- BGH, Urteil vom 21.06.2016 – II ZR 331/14, ZIP 2016, 1478 Rn. 13; Urteil vom 09.07.2013 – II ZR 9/12, ZIP 2013, 1616 Rn. 33; Urteil vom 23.04.2012 – II ZR 211/09, ZIP 2012, 1231 Rn. 13[↩]
- BGH, Urteil vom 16.03.2017 – III ZR 489/16, ZIP 2017, 715 Rn.19; Urteil vom 03.11.2015 – II ZR 270/14, WM 2016, 72 Rn. 13 beide mwN[↩]
- BGH, Urteil vom 03.11.2015 – II ZR 270/14, WM 2016, 72 Rn. 13; Urteil vom 05.03.2013 – II ZR 252/11, ZIP 2013, 773 Rn. 14 mwN[↩]
- BGH, Beschluss vom 29.07.2014 – II ZB 30/12, ZIP 2014, 2284 Rn. 66; Urteil vom 05.03.2013 – II ZR 252/11, ZIP 2013, 773 Rn. 14; Beschluss vom 13.12 2011 – II ZB 6/09, ZIP 2012, 117 Rn. 37[↩]
- BGH, Beschluss vom 29.07.2014 – II ZB 30/12, ZIP 2014, 2284 Rn. 66 mwN; Beschluss vom 13.12 2011 – II ZB 6/09, ZIP 2012, 117 Rn. 25[↩]
- BGH, Urteil vom 21.06.2016 – II ZR 331/14, ZIP 2016, 1478 Rn. 15; Urteil vom 23.10.2012 – II ZR 294/11, ZIP 2013, 315 Rn. 11 mwN[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 11.10.2016 – XI ZR 14/16, WM 2016, 2216 Rn. 3; Urteil vom 11.12 2014 – III ZR 365/13, ZIP 2015, 431 Rn. 24[↩]
- BGH, Urteil vom 09.07.2013 – II ZR 9/12, ZIP 2013, 1616[↩]
- BGH, Beschluss vom 29.07.2014 – II ZB 30/12, ZIP 2014, 2284 Rn. 64; Urteil vom 14.07.2003 – II ZR 202/02, ZIP 2003, 1651, 1653[↩]
- BGH, Beschluss vom 29.07.2014 – II ZB 30/12, ZIP 2014, 2284 Rn. 64; Urteil vom 23.07.2013 – II ZR 143/12, ZIP 2013, 1761 Rn. 12[↩]
- BGH, Beschluss vom 29.07.2014 – II ZB 30/12, ZIP 2014, 2284 Rn. 64 mwN[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 23.09.2014 – II ZR 317/13 18[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 16.09.2010 – III ZR 14/10, ZIP 2010, 2206 Rn. 11[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 03.02.2015 – II ZR 93/14, BKR 2016, 38 Rn. 13 mwN[↩]