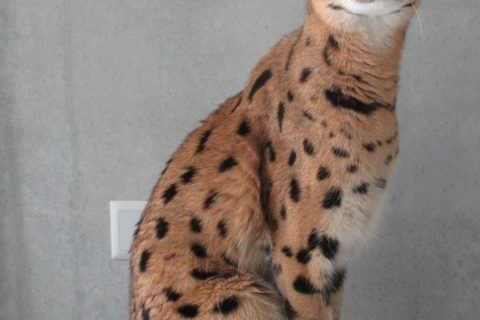Im Fall der südafrikanischen Leichtathletin Mokgadi Caster Semenya hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mehrheitlich (mit 4 gegen 3 Stimmen) festgestellt, dass mit dem Urteil des Court of Arbitration for Sport (CAS) und der dieses bestätigende Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts eine Verletzung von Artikel 14 (Diskriminierungsverbot) in Verbindung mit Artikel 8 (Recht auf Achtung des Privatlebens) der Europäischen Menschenrechtskonvention sowie eine Verletzung von Artikel 13 (Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf) in Verbindung mit Artikel 14 in Verbindung mit Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention vorliegt.

Der Fall betraf eine internationale Spitzenathletin, die sich auf Mittelstreckenläufe spezialisiert hatte. Sie beschwerte sich über bestimmte Vorschriften des Internationalen Leichtathletik-Verbandes (IAAF – jetzt World Athletics), die von ihr eine Hormonbehandlung zur Senkung ihres natürlichen Testosteronspiegels verlangten, um an internationalen Wettkämpfen in der Kategorie Frauen teilnehmen zu können. Da sie sich weigerte, sich der Behandlung zu unterziehen, konnte sie nicht mehr an internationalen Wettkämpfen teilnehmen. Ihre Klagen gegen die fraglichen Regelungen vor dem Court of Arbitration for Sport (CAS) und dem Bundesgericht wurden abgewiesen.
Der EGMR stellte insbesondere fest, dass die Leichtathletin in der Schweiz keine ausreichenden institutionellen und verfahrensrechtlichen Garantien erhalten hatte, die es ihr ermöglicht hätten, ihre Beschwerden wirksam prüfen zu lassen, zumal es sich bei ihren Beschwerden um begründete und glaubwürdige Behauptungen einer Diskriminierung aufgrund ihres erhöhten Testosteronspiegels infolge von Unterschieden in der Geschlechtsentwicklung (DSD) handelte. Daraus ergab sich, insbesondere im Hinblick auf den hohen persönlichen Einsatz, der für die Leichtathletin auf dem Spiel stand – nämlich die Teilnahme an Leichtathletikwettkämpfen auf internationaler Ebene und damit die Ausübung ihres Berufs -, dass die Schweiz den engen Ermessensspielraum, der ihr im vorliegenden Fall eingeräumt wurde, überschritten hatte, da es sich um eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und sexueller Merkmale handelte, für die „sehr gewichtige Gründe“ als Rechtfertigung erforderlich waren. Da für die Leichtathletin viel auf dem Spiel stand und der beklagte Staat nur über einen engen Ermessensspielraum verfügte, hätte eine gründliche institutionelle und verfahrenstechnische Überprüfung erfolgen müssen, aber die Leichtathletin war nicht in der Lage, eine solche Überprüfung zu erreichen. Der EGMR stellte außerdem fest, dass die der Leichtathletin zur Verfügung stehenden innerstaatlichen Rechtsbehelfe unter den Umständen des vorliegenden Falles nicht als wirksam angesehen werden konnten.
Der „Fall“ der Makdagi Caster Semenya
Die Leichtathletin, Mokgadi Caster Semenya, ist eine südafrikanische Staatsangehörige, die 1991 geboren wurde und in Pretoria (Südafrika) lebt. Sie ist eine internationale Spitzenathletin, die sich auf Mittelstreckenläufe (800 bis 3.000 m) spezialisiert hat. Nach ihrem Sieg im 800-m-Lauf der Frauen bei den Weltmeisterschaften 2009 in Berlin teilte der Internationale Leichtathletikverband (IAAF) der Leichtathletin mit, dass sie ihren Testosteronspiegel unter einen bestimmten Schwellenwert senken müsse, wenn sie bei künftigen internationalen Leichtathletikwettbewerben in ihren bevorzugten Disziplinen antreten wolle.
Trotz der erheblichen Nebenwirkungen der Hormonbehandlung, der sie sich daraufhin unterzog, gewann die Leichtathletin den 800-m-Lauf der Frauen bei den Weltmeisterschaften in Daegu (2011) und den Olympischen Spielen in London (2012).
Nach dem vorläufigen Schiedsspruch vom 24. Juli 2015 im Fall Dutee Chand, in dem der Court of Arbitration for Sport (CAS) die damals geltenden IAAF-Regeln vorübergehend aussetzte, stellte die Leichtathletin ihre Hormonbehandlung ein.
Im April 2018 verabschiedete die IAAF ein neues Regelwerk mit dem Titel „Eligibility Regulations for the Female Classification (Athletes with Differences of Sex Development)“ – „die DSD-Regeln“. Die Leichtathletin, die nicht bestritt, eine „relevante Athletin“ im Sinne der DSD-Regeln zu sein, weigerte sich, diese einzuhalten, da sie ihrer Ansicht nach verpflichtet war, sich einer Hormonbehandlung mit schlecht verstandenen Nebenwirkungen zu unterziehen, um ihren natürlichen Testosteronspiegel zu senken, damit sie in der weiblichen Kategorie an einem internationalen Wettkampf teilnehmen durfte.
Im Juni 2018 focht die Leichtathletin die Gültigkeit des DSD-Reglements vor dem CAS mit Sitz in Lausanne an. Während des Verfahrens änderte die IAAF die Liste der Unterschiede in der Geschlechtsentwicklung (DSD), die unter das DSD-Reglement fallen; von diesem Zeitpunkt an galt es nur noch für „46 XY DSD“-Athleten, also für Personen mit XY-Chromosomen, nicht aber für solche mit XX-Chromosomen. Mit anderen Worten, Athleten mit XX-Chromosomen, die einen erhöhten Testosteronspiegel haben, fielen nicht mehr unter diese Regelungen. Im April 2019 wies der CAS den Antrag der Leichtathletin auf ein Schiedsverfahren ab; er befand, dass die DSD-Regelungen zwar diskriminierend seien, aber ein notwendiges, angemessenes und verhältnismäßiges Mittel zur Erreichung der Ziele der IAAF darstellten, nämlich einen fairen Wettbewerb sicherzustellen1.
Im Mai 2019 reichte die Leichtathletin eine Zivilklage beim Bundesgericht ein, in der sie insbesondere geltend machte, dass sie aufgrund ihres Geschlechts gegenüber männlichen und weiblichen Athleten ohne DSD diskriminiert worden sei und dass ihre Menschenwürde und ihre Persönlichkeitsrechte verletzt worden seien.
Im August 2020 wies das Bundesgericht die Klage der Leichtathletin ab und vertrat die Auffassung, dass die einschlägigen Regelungen ein geeignetes, notwendiges und verhältnismäßiges Mittel seien, um die legitimen Ziele der Fairness im Sport und der Aufrechterhaltung der „geschützten Klasse“ zu erreichen. Es wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass seine Kontrollbefugnis im Bereich der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit auf die Prüfung der Frage beschränkt sei, ob der angefochtene Schiedsspruch mit der materiellen öffentlichen Ordnung (ordre public) unvereinbar sei, und kam zu dem Schluss, dass dies nicht der Fall sei.
Unter Berufung auf Artikel 14 (Diskriminierungsverbot) in Verbindung mit Artikel 8 (Recht auf Achtung des Privatlebens) der Europäischen Menschenrechtskonvention beschwerte sich die Leichtathletin daraufhin beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte darüber, dass sie aufgrund ihrer DSD, die zu einem natürlich höheren Testosteronspiegel führte, einer diskriminierenden Behandlung unterzogen worden sei. Unter Berufung auf Artikel 13 (Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf) in Verbindung mit den Artikeln 3, 8 und 14 der Konvention beschwerte sich die Leichtathletin desweiteren über die begrenzte Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts. Sie berief sich auch auf Artikel 3 (Verbot unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung), Artikel 6 (Recht auf ein faires Verfahren) und Artikel 8 (Recht auf Achtung des Privatlebens) der Konvention.
Entscheidung des Gerichtshofs
Gegenstand der Rechtssache
Der EGMR stellte fest, dass die Leichtathletin im Wesentlichen die Vereinbarkeit bestimmter Vorschriften, die von der IAAF (einem monegassischen privatrechtlichen Verband) erlassen und anschließend vom CAS und vom Schweizer Bundesgericht bestätigt worden waren, mit verschiedenen Bestimmungen der Konvention anfechtete. Er stellte ferner fest, dass die Schweiz an der Verabschiedung des DSD-Reglements nicht beteiligt war. Der EGMR beschloss daher, sich bei seiner Prüfung auf die Frage zu konzentrieren, ob die vom TAS und vom Bundesgericht durchgeführte Überprüfung im vorliegenden Fall den Anforderungen der Konvention entsprochen hatte.
Zuständigkeit des EGMR
Im Rahmen der Zwangsschlichtung, die der Leichtathletin die Möglichkeit genommen hatte, sich an die ordentlichen Gerichte in ihrem eigenen Land oder anderswo zu wenden, bestand der einzige Rechtsbehelf, der der Leichtathletin zur Verfügung stand, in einem Antrag auf ein Schiedsverfahren beim TAS, gefolgt von einem Rechtsbehelf gegen die Ablehnung des Schiedsverfahrens beim Bundesgericht. Ein anderer Rechtsbehelf, insbesondere die Anrufung anderer schweizerischer oder monegassischer Gerichte, stand ihr nicht zur Verfügung.
Der EGMR leugnete nicht, dass ein „zentralisiertes“ System zur Behandlung von Streitigkeiten im Bereich des Sports seine Vorteile hat, insbesondere um eine gewisse Kohärenz und Konsistenz in der internationalen Rechtsprechung durch den TAS zu gewährleisten. Sollte der EGMR jedoch feststellen, dass er für die Prüfung dieser Art von Anträgen nicht zuständig ist, bestünde die Gefahr, dass er einer ganzen Kategorie von Personen, nämlich der der Berufssportler, den Zugang zum EGMR verwehrt, was nicht dem Geist, dem Ziel und dem Zweck der Konvention entspräche.
Dem EGMR war bekannt, dass die Leichtathletin vor ihm die Vereinbarkeit eines von der IAAF erlassenen und vom TAS bestätigten Reglements mit der Konvention beanstandete, da es sich bei beiden um nichtstaatliche Akteure handelt. Soweit die Feststellungen des TAS jedoch vom Bundesgericht in Bezug auf die Beschwerden der Leichtathletin überprüft worden waren, kam der EGMR im Lichte seiner Rechtsprechung zu dem Schluss, dass der Fall der Leichtathletin in die „Zuständigkeit“ der Schweiz im Sinne von Artikel 1 (Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte) der Konvention fiel. Dies war der Fall, obwohl das Schweizerische Bundesgericht nicht ausdrücklich auf die Bestimmungen der Konvention Bezug genommen hatte und nur über eine begrenzte Überprüfungsbefugnis verfügte, die sich auf die Frage beschränkte, ob der angefochtene Schiedsspruch mit der materiellen öffentlichen Ordnung (ordre public) vereinbar gewesen war. Daraus folgte, dass der EGMR für die Prüfung des vorliegenden Falles zuständig war.
Verletzung von Artikel 14 in Verbindung mit Artikel 8 EMRK (Diskriminierungsverbot)
Der EGMR stellte fest, dass sich die Leichtathletin auf mindestens einen Diskriminierungsgrund nach Artikel 14 berufen konnte und dass sie geltend machen konnte, Opfer einer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und auch aufgrund sexueller Merkmale (insbesondere genetischer Merkmale) zu sein, ein Begriff, der in den Anwendungsbereich von Artikel 14 fällt.
Der EGMR vertrat die Auffassung, dass sich die Leichtathletin in einer vergleichbaren Situation befand wie andere weibliche Athleten und dass sie im Vergleich zu diesen Athleten einer unterschiedlichen Behandlung ausgesetzt war, da sie aufgrund der DSD-Verordnung von der Teilnahme an Wettkämpfen ausgeschlossen worden war. Der EGMR hatte zu prüfen, ob der Leichtathletin ausreichende institutionelle und verfahrensrechtliche Garantien in Form eines Systems von Gerichten zur Verfügung standen, bei denen sie ihre Beschwerden, insbesondere nach Artikel 14, einreichen konnte, und ob diese Gerichte mit Gründen versehene Entscheidungen erlassen hatten, die der Rechtsprechung des Gerichtshofs Rechnung trugen.
Er erinnerte daran, dass er wiederholt entschieden hatte, dass eine ausschließlich auf dem Geschlecht beruhende Ungleichbehandlung „sehr gewichtige Gründe“, „besonders schwerwiegende Gründe“ oder – in einer anderen Formulierung – „besonders gewichtige und überzeugende Gründe“ zur Rechtfertigung erfordere. Ähnliche Überlegungen galten, wenn eine unterschiedliche Behandlung auf den sexuellen Merkmalen einer Person oder ihrem Status als intersexuelle Person beruhte.
Der EGMR nahm als nächstes die folgenden Punkte zur Kenntnis: die Überprüfungsbefugnis des CAS und des Bundesgerichts, die wissenschaftliche Unsicherheit hinsichtlich der Rechtfertigung der DSD-Verordnungen, die Interessenabwägung und die Berücksichtigung der durch die Zwangsmedikation verursachten Nebenwirkungen, die horizontale Wirkung der Diskriminierung und den Vergleich mit der Situation von Transgender-Sportlern.
Der EGMR stellte unter anderem fest, dass die Leichtathletin sowohl vor dem CAS als auch vor dem Bundesgericht eine Beschwerde eingereicht hatte, deren Ernsthaftigkeit und Begründetheit von diesen Gerichten nicht bestritten worden war. Es stellte ferner fest, dass der CAS selbst in mindestens drei Punkten ernsthafte Bedenken gegen das DSD-Reglement geäußert hatte: Er hatte eingeräumt, dass die Nebenwirkungen der Hormonbehandlung „signifikant“ seien; er hatte auch eingeräumt, dass Sportlerinnen, selbst wenn sie die vorgeschriebene Hormonbehandlung sorgfältig befolgten, möglicherweise nicht in der Lage seien, das DSD-Reglement einzuhalten; und schließlich hatte er die Auffassung vertreten, dass die Beweise dafür, dass 46 XY-DSD-Athleten tatsächlich einen signifikanten sportlichen Vorteil bei den 1.500-m- und 1-Meile-Läufen hätten, „spärlich“ seien. Diese schwerwiegenden Bedenken hatten jedoch nicht dazu geführt, dass der CAS die fraglichen Bestimmungen aussetzte, wie er es einige Jahre zuvor im Fall Dutee Chand getan hatte. Der Bundesgerichtshof hatte nicht versucht, die vom CAS geäußerten Zweifel an der praktischen Anwendung und der wissenschaftlichen Grundlage der DSD-Regeln auszuräumen. Andererseits stellte der EGMR fest, dass in den jüngsten Berichten von Menschenrechtsgremien, insbesondere der Parlamentarischen Versammlung des Europarats und des Büros des Hohen Kommissars für Menschenrechte, ernste Bedenken hinsichtlich der Diskriminierung von Frauen im Sportbereich, einschließlich intersexueller Sportlerinnen, aufgrund von Regelungen wie der im vorliegenden Fall in Rede stehenden, geäußert wurden.
Zusammenfassend stellte der EGMR fest, dass im Rahmen des obligatorischen Schiedsverfahrens, das der Leichtathletin die Möglichkeit genommen hatte, sich an die ordentlichen Gerichte zu wenden, der einzige ihr zur Verfügung stehende Rechtsbehelf eine Klage vor dem TAS gewesen war, das trotz einer sehr ausführlichen Begründung die Bestimmungen der Konvention nicht angewandt und ernsthafte Fragen zur Gültigkeit der DSD-Regelungen offen gelassen hatte, insbesondere in Bezug auf: die Nebenwirkungen der Hormonbehandlung; die potenzielle Unfähigkeit der Athleten, das DSD-Reglement einzuhalten; und das Fehlen von Beweisen, dass Athleten mit 46 XY DSD tatsächlich einen signifikanten sportlichen Vorteil bei den 1.500- und 1-Meilen-Läufen haben. Darüber hinaus war die Prüfung, die das Bundesgericht bei einer Berufung gegen eine CAS-Entscheidung vornahm, sehr begrenzt, da sie sich auf die Frage beschränkte, ob der Schiedsspruch mit der materiellen öffentlichen Ordnung (ordre public) vereinbar war, und im vorliegenden Fall hatte es versäumt, auf die vom CAS geäußerten schwerwiegenden Bedenken in einer Weise einzugehen, die mit den Anforderungen von Artikel 14 des Übereinkommens vereinbar war.
Der EGMR stellte folglich fest, dass die Leichtathletin in der Schweiz keine ausreichenden institutionellen und verfahrensrechtlichen Garantien erhalten hatte, die es ihr ermöglicht hätten, ihre Beschwerden wirksam prüfen zu lassen, zumal ihre Beschwerden begründete und glaubwürdige Behauptungen über eine Diskriminierung aufgrund ihres durch DSD verursachten erhöhten Testosteronspiegels betrafen. Daraus folgt, insbesondere im Hinblick auf den hohen persönlichen Einsatz, der für die Leichtathletin auf dem Spiel steht – nämlich die Teilnahme an Leichtathletikwettkämpfen auf internationaler Ebene und damit die Ausübung ihres Berufs -, dass die Schweiz den engen Ermessensspielraum, der ihr im vorliegenden Fall eingeräumt wurde, überschritten hat, da es sich um eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und der sexuellen Merkmale handelt, die „sehr gewichtige Gründe“ als Rechtfertigung erfordert. Da für die Leichtathletin viel auf dem Spiel stand und der beklagte Staat nur über einen engen Ermessensspielraum verfügte, hätte eine gründliche institutionelle und verfahrenstechnische Überprüfung erfolgen müssen, doch war die Leichtathletin im vorliegenden Fall nicht in der Lage, eine solche Überprüfung zu erreichen. Infolgedessen konnte der EGMR nicht feststellen, ob die DSD-Verordnung, wie sie im Fall der Leichtathletin angewandt wurde, als eine Maßnahme angesehen werden kann, die objektiv und verhältnismäßig im Hinblick auf das verfolgte Ziel war. Es lag daher eine Verletzung von Artikel 14 in Verbindung mit Artikel 8 der Konvention vor.
Verletzung von Artikel 13 in Verbindung mit den Artikeln 8 und 14 EGMR (Effektiver Rechtsschutz)
Der EGMR stellte auch eine Verletzung des Rechts auf einen wirksamen Rechtsbehelf im Sinne von Artikel 13 der Konvention fest, und zwar im Wesentlichen aus denselben Gründen, die ihn veranlasst hatten, eine Verletzung von Artikel 14 in Verbindung mit Artikel 8 festzustellen, nämlich das Fehlen ausreichender institutioneller und verfahrensrechtlicher Garantien in der Schweiz.
Es stellte fest, dass die Beschwerden, die die Beschwerdeführerin beim CAS und beim Bundesgerichtshof eingereicht hatte, begründet waren und sich direkt oder inhaltlich auf die Konvention gestützt hatten. In ihrer Beschwerde vor dem Bundesgericht gegen die Entscheidung vom 28. Mai 2019, das Schiedsverfahren abzulehnen, hatte die Beschwerdeführerin insbesondere eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts gegenüber männlichen und weiblichen Sportlern ohne DSD sowie eine Verletzung ihres Rechts auf Würde und ihrer Persönlichkeitsrechte gerügt. Als solche hatte sie dem Bundesgericht die Gelegenheit gegeben, über diese Beschwerden zu entscheiden. Das Bundesgericht hatte jedoch, wie zuvor der TAS, insbesondere aufgrund seiner sehr begrenzten Überprüfungsbefugnis nicht wirksam auf die substantiierten und glaubwürdigen Beschwerden der Leichtathletin u. a. wegen Diskriminierung reagiert.
Der EGMR kam in seiner begrenzten Rolle als Hüter der europäischen öffentlichen Ordnung zu dem Schluss, dass die der Leichtathletin zur Verfügung stehenden innerstaatlichen Rechtsbehelfe unter den besonderen Umständen des vorliegenden Falles nicht als wirksam im Sinne von Artikel 13 der Konvention angesehen werden konnten. Es liege daher eine Verletzung von Artikel 13 in Bezug auf Artikel 14 in Verbindung mit Artikel 8 der Konvention vor.
Verletzung weiterer EMRK-Menschenrechte
Der EGMR entschied mit 6 zu 1 Stimmen, dass weder über die Beschwerden nach Artikel 8 allein noch über die Beschwerde nach Artikel 6 § 1 der Konvention gesondert entschieden werden müsse.
Mehrheitlich erklärte er die Beschwerde nach Artikel 3 für unzulässig, da sie offensichtlich unbegründet sei.
Gerechte Entschädigung (Artikel 41)
Da die Leichtathletin keine Ansprüche in Bezug auf finanzielle oder immaterielle Schäden geltend gemacht hat, sprach der EGMR keine Entschädigung in diesen Bereichen aus. Er entschied jedoch (mit 4 gegen 3 Stimmen), dass die Schweiz dem Kläger 60.000 Euro für Kosten und Auslagen zu zahlen hat.
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Urteil vom 11. Juli 2023 – 10934/21 [Semenya v. Switzerland]
- CAS/2018/O/5794[↩]