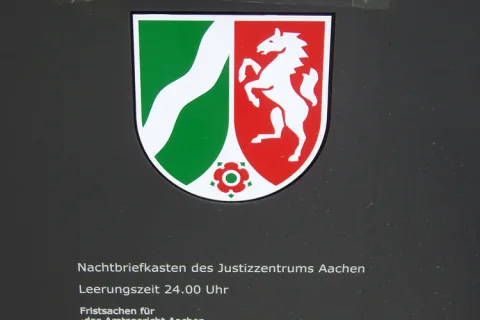Nach § 86 Abs. 1 VwGO, § 58 Abs. 1 BDG und § 41 DiszG Berlin obliegt den Tatsachengerichten die Pflicht, jede mögliche Aufklärung des entscheidungserheblichen Sachverhalts bis zur Grenze der Zumutbarkeit zu versuchen, sofern dies nach ihrem materiellrechtlichen Rechtsstandpunkt für die Entscheidung des Rechtsstreits erforderlich ist1.

Bestehen tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass die Fähigkeit des Beamten, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, wegen einer seelischen Störung im Sinne von § 20 StGB erheblich gemindert war, so darf das Verwaltungsgericht diesen Aspekt nicht ohne Sachaufklärung zu Gunsten des Beamten unterstellen, ihm aber bei der Bestimmung der Disziplinarmaßnahme kein Gewicht beimessen. Vielmehr muss es die Frage einer Minderung der Schuldfähigkeit des Beamten aufklären.
Hat der Beamte zum Tatzeitpunkt an einer krankhaften seelischen Störung im Sinne von § 20 StGB gelitten oder kann eine solche Störung nach dem Grundsatz „in dubio pro reo“ nicht ausgeschlossen werden und ist die Verminderung der Schuldfähigkeit des Beamten erheblich, so ist dieser Umstand bei der Bewertung der Schwere des Dienstvergehens mit dem ihm zukommenden erheblichen Gewicht heranzuziehen. Bei einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit kann die Höchstmaßnahme regelmäßig nicht mehr ausgesprochen werden2.
Daran gemessen muss geklärt werden, ob der Beamte im Tatzeitraum an einer seelischen Störung im Sinne von § 20 StGB gelitten hat, die seine Fähigkeit, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, vermindert hat. Hierfür bedarf es in der Regel besonderer medizinischer Sachkunde. Erst wenn die seelische Störung und ihr Schweregrad feststehen oder nach dem Grundsatz „in dubio pro reo“ nicht ausgeschlossen werden können, kann beurteilt werden, ob die Voraussetzung für eine erheblich geminderte Schuldfähigkeit vorliegen. Denn von den Auswirkungen der krankhaften seelischen Störung auf die Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit in Bezug auf das Verhalten des Beamten hängt im Disziplinarrecht die Beurteilung der Erheblichkeit einer verminderten Schuldfähigkeit im Sinne von § 21 StGB ab. Die Frage, ob die Verminderung der Steuerungsfähigkeit aufgrund einer krankhaften seelischen Störung „erheblich“ war, ist eine Rechtsfrage, die die Verwaltungsgerichte in eigener Verantwortung zu beantworten haben. Hierzu bedarf es einer Gesamtschau der Persönlichkeitsstruktur des Betroffenen, seines Erscheinungsbildes vor, während und nach der Tat und der Berücksichtigung der Tatumstände, insbesondere der Vorgehensweise3.
Aufgrund des Vorbringens des Beamten auch im Berufungsverfahren bestand hinreichender Anlass, der entscheidungserheblichen Frage der erheblichen Verminderung der Schuldfähigkeit des Beamten zum Tatzeitpunkt nachzugehen. Auch hat der Beklagte in der Berufungsverhandlung für den Fall, dass sein Antrag auf Änderung des Urteils des Verwaltungsgerichts und Abweisung der Klage erfolglos bleibt, beantragt, ein Gutachten eines forensischen Psychiaters zum Beweis der Tatsache einzuholen, dass er sich im Zeitpunkt der Tat aufgrund starken Alkohol- und Drogenkonsums im Verbund mit einer Depression in einem Zustand zumindest erheblich verminderter Schuldfähigkeit befand.
Ob das Oberverwaltungsgericht den erwähnten Hilfsbeweisantrag verfahrensfehlerfrei mit der Begründung hätte ablehnen können, dass es sich – jedenfalls bei den erstmals in der mündlichen Verhandlung vom Beamten behaupteten Cannabis-Konsum – um gesteigertes, daher unglaubhaftes Vorbringen handelte und deshalb keine hinreichenden Anhaltspunkte für den behaupteten Entlastungsgrund vorlagen, kann dahinstehen. Diesen Weg ist das Oberverwaltungsgericht nicht gegangen. Es hat vielmehr seiner rechtlichen Würdigung die Angaben des Beamten zu dem von ihm behaupteten Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum zugrunde gelegt. Nach diesen tatsächlichen Annahmen des Oberverwaltungsgerichts hat der Beklagte während eines Zeitraums von sechs Monaten vor dem Tatzeitpunkt regelmäßig täglich Bier und Kräuterlikör sowie Cannabis konsumiert. Hierzu hat das Oberverwaltungsgericht ausgeführt, es sei auszuschließen, dass der damit vom Beamten beschriebene Missbrauch in Gestalt des Alkohol- und Betäubungsmittelkonsums während dieser vergleichsweise kurzen Zeitspanne eine schwere psychische Persönlichkeitsveränderung nach sich gezogen haben könnte. Für eine solche Bewertung der Folgen eines regelmäßigen Cannabiskonsums sowie eines regelmäßigen Parallelkonsums von Alkohol und Cannabis bedarf es medizinischer Sachkunde, über die ein Gericht nicht verfügt. Dementsprechend muss das Gericht zur Bewertung der Auswirkungen in aller Regel sachverständige Hilfe in Anspruch nehmen. Glaubt das Gericht, die erforderliche medizinische Sachkunde ausnahmsweise selbst zu besitzen und auf sachverständige Hilfestellung verzichten zu können, muss es dies darlegen4. Dem Berufungsurteil ist aber nicht zu entnehmen, woraus sich dieser vom Oberverwaltungsgericht für sich in Anspruch genommene Sachverstand – ausnahmsweise – ergibt. Auch hat das Oberverwaltungsgericht nicht ermittelt, welche Mengen Alkohol und Cannabis der Beklagte, der in der Zeit vom 25.04.bis zum 26.05.2003 dienstunfähig erkrankt war, täglich konsumiert hat. Es hat sich ferner nicht mit der allgemeinkundigen wissenschaftlichen Erkenntnis auseinandergesetzt, dass der kombinierte Konsum von Cannabis und Alkohol zu einer Potenzierung der Wirkungen beider Stoffe führt und deshalb psychotische Störungen oder Beeinträchtigungen des Herz-Kreislauf-Systems zur Folge haben kann5.
Ferner ergibt sich aus den Feststellungen des Oberverwaltungsgerichts, dass dem Attest des den Beamten im Tatzeitraum behandelnden Facharztes Hinweise darauf zu entnehmen sind, dass der Beklagte bereits im April 2003 an einem Burnout-Syndrom gelitten habe, welches durch eine deutlich depressive Stimmung dominiert gewesen sei. Auch dieser Diagnose hat das Oberverwaltungsgericht jegliche Bedeutung für die forensische Bewertung des psychischen Zustands des Beamten im Mai 2003 abgesprochen, ohne seine für eine solche Bewertung erforderliche medizinische Sachkunde darzulegen.
Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 28. Januar 2015 – 2 B 15.2014 –
- vgl. BVerwG, Urteile vom 06.02.1985 – 8 C 15.84, BVerwGE 71, 38, 41; und vom 06.10.1987 – 9 C 12.87, Buchholz 310 § 98 VwGO Nr. 31 S. 1[↩]
- BVerwG, Urteil vom 25.03.2010 – 2 C 83.08, BVerwGE 136, 173 Rn. 29 ff.; Beschluss vom 20.10.2011 – 2 B 61.10 9[↩]
- stRspr, vgl. BVerwG, Urteil vom 29.05.2008 – 2 C 59.07 30[↩]
- stRspr, vgl. etwa BVerwG, Beschlüsse vom 21.02.2014 – 2 B 24.12 – IÖD 2014, 100 Rn. 10; und vom 26.05.2014 – 2 B 69.12 – NJW 2014, 2971 Rn. 10 m.w.N.[↩]
- BayVGH, Urteil vom 12.03.2012 – 11 B 10.955 – SVR 2012, 396 Rn. 54 m.w.N. und VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 19.08.2013 – 10 S 206/13 – NJW 2014, 410 Rn. 6 m.w.N.[↩]