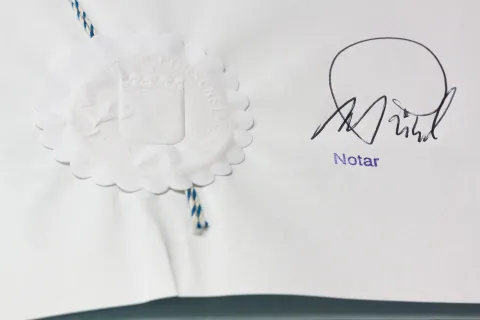Der Verkäufer kann jederzeit und auch stillschweigend auf die Rechtsfolgen aus § 377 Abs. 2, 3 HGB – beziehungsweise auf den Einwand der Verspätung einer Mängelrüge – verzichten. Hierfür müssen jedoch eindeutige Anhaltspunkte vorliegen, die der Käufer als (endgültige) Aufgabe des Rechts – hier: des Verspätungseinwands – durch den Verkäufer verstehen darf1.

Solche eindeutigen Anhaltspunkte lassen sich grundsätzlich noch nicht ohne Weiteres einem Schreiben des Fahrzeugverkäufers entnehmen, mit dem der Fahrzeugkäufer über die Bereitstellung eines Software-Updates durch den Fahrzeughersteller unterrichtet, um die Vereinbarung eines Termins zum Aufspielen des Updates in der Werkstatt des Fahrzeugverkäufers gebeten und auf die Übernahme der Kosten der Maßnahme durch den Hersteller sowie die Möglichkeit einer für den Fahrzeugkäufer kostenlosen Überlassung eines Ersatzfahrzeugs für die Dauer der Maßnahme hingewiesen wird.
Nach der Vorschrift des § 377 Abs. 1 HGB hat im Falle eines beidseitigen Handelsgeschäfts der Käufer die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer, soweit dies nach ordnungsmäßigem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. Unterlässt er die Anzeige, gilt die Ware gemäß § 377 Abs. 2 HGB als genehmigt, es sei denn, der Mangel war bei der Untersuchung nicht erkennbar. Nach § 377 Abs. 3 HGB muss, wenn sich ein solcher Mangel später zeigt, die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht werden; anderenfalls gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt.
Rechtsfolge einer verspäteten Mängelanzeige ist die gesetzliche Fiktion, dass die Ware trotz des ihr anhaftenden Sachmangels als vertragsgerecht anzusehen ist2. Die Frage der vertragsmäßigen Beschaffenheit der Ware ist in einem solchen Fall dem Streit der Parteien entzogen3. Die in § 437 BGB normierten Gewährleistungsrechte des Käufers und damit auch ein Rücktritt vom Kaufvertrag (§ 437 Nr. 2 BGB) sind dann – vorbehaltlich anderer, aber erst später sichtbar werdender verdeckter Mängel – ausgeschlossen4.
Diese Vorschrift findet im hier vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall auf den zwischen der Autokäuferin und der Verkäuferin am 7.04.2015 geschlossenen Kaufvertrag Anwendung, weil es sich bei diesem – wie das in der Vorinstanz tätige Berliner Kammergericht5 seiner Würdigung zu § 377 Abs. 3 HGB unausgesprochen zugrunde gelegt hat – um einen beiderseitigen Handelskauf im Sinne des § 343 HGB handelt. Die diesbezüglichen tatsächlichen Feststellungen des Kammergerichts lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen und werden von den Parteien im Revisionsverfahren nicht angegriffen.
Im hier entschiedenen Fall ist die Verkäuferin ihrer Rügeobliegenheit gemäß § 377 Abs. 3 HGB nicht rechtzeitig nachgekommen, so dass der in der unzulässigen Abschalteinrichtung liegende Mangel als genehmigt gilt. Sie hat erstmalig in der Rücktrittserklärung vom 15.11.2016 eine diesbezügliche Mangelhaftigkeit des Fahrzeugs gegenüber der Verkäuferin gerügt, was nach den von der höchstrichterlichen Rechtsprechung geprägten Grundsätzen nicht als unverzüglich nach Entdeckung anzusehen ist.
Die Rügeobliegenheit setzt mit dem Vorliegen eines Mangels der Sache und dessen Erkennbarkeit ein6. Ein verdeckter Mangel – um einen solchen handelt es sich bei der hier gegebenen Ausstattung des Fahrzeugs mit einem über eine unzulässige Abschalteinrichtung verfügenden Motor – muss unverzüglich nach seiner Entdeckung angezeigt werden. Da es dann lediglich noch um die Mitteilung des (bereits entdeckten) Mangels geht, kann und muss die Rüge im Rahmen der geschäftlichen Korrespondenz eines ordentlichen Kaufmanns (§ 347 Abs. 1 HGB) regelmäßig ohne weitere Verzögerung erfolgen7.
Die Vorschrift des § 377 HGB ist im Interesse der im Handelsverkehr unerlässlichen schnellen Abwicklung der Handelsgeschäfte streng auszulegen8. Es soll möglichst schnell Klarheit darüber geschaffen werden, ob das Geschäft ordnungsgemäß abgewickelt worden ist; der Verkäufer, dessen Interessen nach der vom Gesetz getroffenen Wertentscheidung der Vorrang zu geben ist, soll durch die den Käufer treffende Obliegenheit zur unverzüglichen Mängelrüge in die Lage versetzt werden, entsprechende Feststellungen und notwendige Dispositionen zu treffen, insbesondere einen möglichen Schaden abwenden zu können, der sich aus Gewährleistungs, Schadensersatz- oder Nachlieferungsansprüchen des Käufers ergeben könnte9.
Deshalb wird dem Käufer im Regelfall eine Erklärungsfrist von (nur) wenigen Tagen zugebilligt10. Jedenfalls ist eine über zwei Wochen nach Entdeckung des Mangels erhobene Mängelrüge nicht mehr „unverzüglich“ im Sinne des § 377 Abs. 3 HGB11.
Unter Zugrundelegung dieses Maßstabs ist die nach den rechtsfehlerfrei getroffenen und im Revisionsverfahren nicht angegriffenen tatsächlichen Feststellungen des Kammergerichts erstmals mit der Rücktrittserklärung der Autokäuferin vom 15.11.2016 erfolgte Mängelanzeige nicht rechtzeitig.
Gezeigt hat sich der in der eingebauten unzulässigen Abschalteinrichtung liegende Mangel des Fahrzeugs für die Autokäuferin spätestens mit dem Zugang des Schreibens vom 14.10.2016, mit dem sie durch die Fahrzeugherstellerin darüber informiert wurde, dass für ihr Fahrzeug nunmehr das erforderliche Software-Update zur Verfügung stehe.
Jedenfalls aufgrund dieser Mitteilung hat die Autokäuferin (sichere) Kenntnis davon erlangt, dass auch in ihrem Fahrzeug die in der Presseberichterstattung seit September 2015 als unzulässige Abschalteinrichtung und technische Manipulation bezeichnete Motorsteuerungssoftware eingebaut und das Fahrzeug somit von dem sogenannten Dieselabgasskandal betroffen ist.
Selbst wenn die Autokäuferin bis dahin aufgrund der Presseberichterstattung nur den Verdacht eines entsprechenden vertragswidrigen Fahrzeugzustands gehabt haben sollte, der allerdings einem sorgfältig handelnden Kaufmann unter den gegebenen Umständen bereits Veranlassung zu einer diesbezüglichen Untersuchung gegeben hätte, so hatte sich dieser Mangelverdacht aufgrund des an sie gerichteten Schreibens der Fahrzeugherstellerin zu einem Mangelbefund verdichtet und spätestens damit die Rügeobliegenheit nach § 377 Abs. 3 HGB ausgelöst12.
Die erstmals mit dem Rücktrittsschreiben vom 15.11.2016 und damit erst mehr als einen Monat nach der Entdeckung erfolgte Anzeige eines diesbezüglichen Mangels des Fahrzeugs bei der Verkäuferin war danach nicht mehr unverzüglich.
Rechtsfehlerhaft hat das Kammergericht einen Verzicht der Verkäuferin auf die Rechtsfolgen des § 377 Abs. 3 HGB bejaht.
Dabei hat es im Ausgangspunkt (noch) richtig gesehen, dass der Verkäufer nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs jederzeit und auch stillschweigend auf die Rechtsfolgen aus § 377 Abs. 2, 3 HGB – beziehungsweise den Einwand der Verspätung einer Mängelrüge – verzichten kann und die Annahme eines solchen Verzichts in Betracht kommt, wenn der Verkäufer die beanstandeten Waren vorbehaltlos zurückgenommen oder vorbehaltlos Nachbesserung versprochen oder den Einwand der verspäteten Mängelanzeige nicht erhoben hat13.
Das Kammergericht hat diesen Maßstab aber rechtsfehlerhaft auf den festgestellten Sachverhalt angewandt. Da ein stillschweigender Verzicht auf Rechte im Allgemeinen nicht zu vermuten ist, müssen eindeutige Anhaltspunkte vorliegen, die der Käufer als Aufgabe des Rechts – hier: des Verspätungseinwands – durch den Vertragspartner verstehen darf14. Solche eindeutigen Anhaltspunkte sind nach den Feststellungen des Kammergerichts im Streitfall jedoch nicht gegeben; sie lassen sich entgegen der Ansicht des Kammergerichts auch nicht dem Schreiben der Verkäuferin vom 10.08.2017 entnehmen.
Die tatrichterliche Auslegung einer Individualerklärung kann vom Revisionsgericht zwar nur daraufhin überprüft werden, ob gesetzliche oder allgemein anerkannte Auslegungsregeln, die Denkgesetze oder allgemeine Erfahrungssätze verletzt sind, wesentlicher Auslegungsstoff außer Acht gelassen worden ist oder die Auslegung auf mit der Revision gerügten Verfahrensfehlern beruht15.
Einer an diesem Maßstab ausgerichteten Prüfung hält die Auslegung des Schreibens vom 10.08.2017 durch das Kammergericht jedoch nicht stand. Die Annahme des Kammergerichts, solche Anhaltspunkte seien vorliegend dem an die Autokäuferin gerichteten Schreiben der Verkäuferin vom 10.08.2017 zu entnehmen, beruht – wie die Revision der Verkäuferin mit Recht geltend macht – auf einer Verletzung anerkannter Auslegungsregeln. Zu diesen gehört es, dass in erster Linie der von der Partei gewählte Wortlaut und der dem Wortlaut zu entnehmende objektiv erklärte Parteiwille zu berücksichtigen ist und dass bei der Auslegung sämtliche Begleitumstände sowie die Interessenlage (§§ 133, 157 BGB) zu beachten sind16. Zudem hat das Kammergericht wesentlichen Auslegungsstoff außer Acht gelassen.
Das Kammergericht hat im Streitfall (allein) auf das Schreiben der Verkäuferin vom 10.08.2017 abgestellt, ohne sich mit dem Wortlaut der darin enthaltenen Erklärung, mit dem Zusammenhang, in welchem die Erklärung erfolgte, sowie mit den berechtigten Interessen der Verkäuferin als Erklärende und der Autokäuferin als Empfängerin dieser Erklärung auseinanderzusetzen. Zur Begründung seiner Bewertung hat es ganz überwiegend Auszüge aus einem Beschluss wörtlich wiedergegeben, der in einem anderen Verfahren angestellte rechtliche Erwägungen zu gänzlich anders lautenden Erklärungen des Verkäufers eines gleichfalls mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung versehenen Fahrzeugs an den Käufer enthält.
In dem vom Kammergericht herangezogenen Schreiben vom 10.08.2017 wurde der Prozessbevollmächtigte der Autokäuferin durch die Prozessbevollmächtigten der Verkäuferin darüber informiert, dass die für das technische Update benötigte Software zur Verfügung stehe und nunmehr das Motorsteuerungsgerät des erworbenen Fahrzeugs umprogrammiert werden könne. Hierbei wies die Verkäuferin darauf hin, dass die mit der Maßnahme verbundenen Kosten von der Fahrzeugherstellerin übernommen würden und dass sie selbst der Autokäuferin – falls diese für die Dauer der Maßnahme ein Ersatzfahrzeug benötige – ein entsprechendes Fahrzeug kostenlos zur Verfügung stellen werde.
Dieser Erklärung der Verkäuferin lassen sich bei einer Auslegung nach dem maßgeblichen objektiven Empfängerhorizont (§§ 133, 157 BGB) keine eindeutigen Anhaltspunkte entnehmen, welche auf eine (endgültige) Aufgabe des Verspätungseinwands nach § 377 Abs. 3 HGB – und der mit diesem verbundenen Rechtsposition (Eintritt der Genehmigungsfiktion) – durch die Verkäuferin schließen lassen.
Das Schreiben diente erkennbar lediglich der (weiteren) Unterrichtung der Autokäuferin als Eigentümerin des Fahrzeugs über das von der Fahrzeugherstellerin zur Verfügung gestellte Software-Update, das – entsprechend der früheren Mitteilung der Fahrzeugherstellerin vom 14.10.2016 selbst über deren Servicepartner und damit auch – über die Verkäuferin aufgespielt werden sollte. Aus ihm ergibt sich für den Erklärungsempfänger lediglich die Einbindung der Verkäuferin in die technische Durchführung der von der Fahrzeugherstellerin gegenüber der Fahrzeugeigentümerin angebotenen Maßnahme. Dies verdeutlicht auch der im Schreiben enthaltene Hinweis, dass die hierdurch bei der Verkäuferin entstehenden Kosten von der Fahrzeugherstellerin getragen würden, also nicht von der Verkäuferin selbst.
Hingegen enthält das Schreiben eine Erklärung der Verkäuferin zu einer etwaigen eigenen Einstandspflicht gegenüber der Autokäuferin aufgrund des geschlossenen Kaufvertrags nicht. Entgegen der Sichtweise des Kammergerichts hat die Verkäuferin mit ihrem Schreiben vom 10.08.2017 nicht vorbehaltlos eine Nachbesserung versprochen. In dem Schreiben geht sie weder auf die Frage ein, ob der Anlass für die dort genannte Umprogrammierung des Motorsteuergeräts durch die Fahrzeugherstellerin überhaupt als vertragswidrige Leistung der Verkäuferin im Verhältnis zur Autokäuferin zu bewerten sei, noch darauf, ob und gegebenenfalls welche Ansprüche der Autokäuferin deshalb gegenüber der Verkäuferin zustünden. Anderes folgt auch nicht aus dem im Schreiben unterbreiteten Angebot der Verkäuferin, der Autokäuferin bei Bedarf für die Dauer der Maßnahme ein Ersatzfahrzeug – kostenlos – zur Verfügung zu stellen. Denn der Zusatz „kostenlos“ lässt aus Sicht der Autokäuferin als Empfängerin des Schreibens lediglich erkennen, dass sie selbst die mit der Fahrzeugüberlassung verbundenen Kosten nicht würde tragen müssen. Er trifft aber keine Aussage dazu, ob diese Kosten auch endgültig von der Verkäuferin getragen oder von dieser – wie auch die Kosten der eigentlichen Maßnahme – letztlich der Fahrzeugherstellerin berechnet werden würden.
Ferner verdeutlicht der auf die Durchführung des Software-Updates bezogene Zusatz „falls noch nicht veranlasst“ aus Sicht des redlichen Empfängers, dass Anlass des Schreibens vom 10.08.2017 nicht die individuelle vertragliche Beziehung zwischen den Parteien oder ein seitens der Autokäuferin bei der Verkäuferin konkret angebrachtes kaufvertragliches Gewährleistungsbegehren war, sondern dass es sich inhaltlich um ein allgemeines Informationsschreiben handelt, das für eine Vielzahl von Fahrzeughaltern formuliert wurde. In einer solchen Mitteilung des Verkäufers, mit der dieser seinen Vertragspartner lediglich über einen ihm von dritter Seite mitgeteilten Sachverhalt (hier die Zurverfügungstellung des Software-Updates durch die Fahrzeugherstellerin und die Einbindung in deren technische Maßnahmen) informiert, ist kein Verzicht auf eigene Rechte – hier: auf den Einwand einer Verspätung der Mängelrüge im eigenen Vertragsverhältnis – zu sehen.
Zudem hat das Kammergericht bei seiner Auslegung weitere maßgebliche Umstände unberücksichtigt gelassen.
Da die Autokäuferin bereits im November 2016 den Rücktritt vom Kaufvertrag erklärt und mit ihrer im April 2017 erhobenen Klage hieraus abgeleitete Ansprüche auf Rückzahlung des Kaufpreises sowie auf Schadensersatz gegen die Verkäuferin geltend gemacht hatte, lässt der erst im August 2017 erfolgte Hinweis der Verkäuferin auf eine diesem Begehren nicht entsprechende Umprogrammierung des Motorsteuerungsgeräts durch eine Software der Fahrzeugherstellerin noch nicht einmal auf die Bereitschaft der Verkäuferin zur Aufnahme von Verhandlungen über die gerügten Mängel schließen17. Noch weniger deutet der Hinweis der Verkäuferin auf eine vorbehaltlose Anerkennung ihrer eigenen Einstandspflicht wegen einer Vertragswidrigkeit des Fahrzeugs hin.
Auch der Umstand, dass die Verkäuferin den Verspätungseinwand nicht bereits in dem (vorgerichtlichen) Schreiben vom 10.08.2017 geltend gemacht hat, kann nicht als stillschweigender Verzicht gedeutet werden18.
Die Verurteilung der Verkäuferin zur Rückzahlung des Kaufpreises nebst Zinsen – und hieran anknüpfend die Feststellung des Annahmeverzugs mit der Rücknahme der Kaufsache – an die Autokäuferin stellt sich auch nicht aus anderen Gründen als richtig dar (§ 561 ZPO). Da die Verkäuferin nicht aufgrund von Treu und Glauben (§ 242 BGB) oder aufgrund eines arglistigen Verschweigens des Sachmangels (§ 377 Abs. 5 HGB) gehindert ist, sich auf eine Verspätung der Mängelanzeige der Autokäuferin gemäß § 377 Abs. 3 HGB zu berufen, sind auf die Mangelhaftigkeit des Fahrzeugs wegen der eingebauten unzulässigen Abschalteinrichtung gestützte Gewährleistungsansprüche der Autokäuferin – neben dem vorrangig geltend gemachten Anspruch aus dem erklärten Rücktritt auch das zuletzt hilfsweise geltend gemachte Begehren auf Lieferung eines Neufahrzeugs aus der aktuellen Produktion – ausgeschlossen. Damit fehlt es auch an der rechtlichen Grundlage für die geltend gemachten Nebenansprüche (Zinsen, Annahmeverzug).
Einer Geltendmachung der aus dem Rügeversäumnis folgenden Rechtsposition des Verkäufers kann zwar Treu und Glauben (§ 242 BGB) entgegenstehen. Die Autokäuferin hat jedoch nichts dafür vorgetragen, dass sie durch ein Verhalten der Verkäuferin – das zudem als treuwidrig zu beurteilen sein müsste – von einer früheren Anzeige des in der unzulässigen Abschalteinrichtung gesehenen Mangels abgehalten wurde19.
Ein etwaiges Rügeversäumnis seitens der Autokäuferin bleibt auch nicht gemäß § 377 Abs. 5 HGB ohne Folgen. Danach kann sich der Verkäufer auf die Vorschriften des § 377 (Abs. 2, 3) HGB nicht berufen, wenn er den Mangel arglistig verschwiegen hat. In einem solchen Fall gilt die gelieferte Ware trotz Versäumung der Rügefrist nicht als genehmigt20. Indes liegen hier diese Voraussetzungen nicht vor. Denn aus den vom Kammergericht rechtsfehlerfrei getroffenen und im Revisionsverfahren nicht angegriffenen Feststellungen ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Verkäuferin von der in das Fahrzeug eingebauten unzulässigen Abschalteinrichtung bei Abschluss des Kaufvertrags wusste oder hätte wissen können. Sie muss sich auch nicht ein etwaiges Fehlverhalten der Fahrzeugherstellerin zurechnen lassen.
Der auf ungeschmälerte Rückzahlung des Kaufpreises ohne Abzug einer Nutzungsentschädigung gerichteten Klage der Autokäuferin bleibt nach den vorstehenden Ausführungen der Erfolg versagt, weil Gewährleistungsansprüche der Autokäuferin infolge ihrer verspätet angebrachten Mängelrüge nach § 377 Abs. 3 HGB ausgeschlossen sind.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 16. November 2022 – VIII ZR 383/20
- im Anschluss an BGH, Urteile vom 19.06.1991 – VIII ZR 149/90, NJW 1991, 2633 unter – II 1 c aa und bb; vom 25.11.1998 – VIII ZR 259/97, NJW 1999, 1259 unter – III 2 a; vom 09.11.2022 – VIII ZR 272/20, unter – II 2 b dd (5) (a) und (b) [↩]
- vgl. BGH, Urteile vom 08.11.1979 – III ZR 115/78, NJW 1980, 782 unter – I 3 c; vom 16.09.1987 – VIII ZR 334/86, BGHZ 101, 337, 348; siehe zur Genehmigungsfiktion auch BGH, Urteile vom 24.02.2016 – VIII ZR 38/15, NJW 2016, 2645 Rn. 33; vom 05.12.2012 – VIII ZR 74/12, NJW 2013, 1299 Rn. 33[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 16.09.1987 – VIII ZR 334/86, aaO S. 343[↩]
- Achilles in Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, HGB, 4. Aufl., § 377 Rn.194 f. mwN[↩]
- KG, Urteil vom 14.01.2020 – 14 U 26/19[↩]
- BGH, Urteil vom 16.09.1987 – VIII ZR 334/86, BGHZ 101, 337, 340[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 10.01.2006 – X ZR 58/03, NJW-RR 2006, 851 Rn.19 [zum Werklieferungsvertrag][↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 30.01.1985 – VIII ZR 238/83, BGHZ 93, 338, 348 mwN[↩]
- BGH, Urteil vom 19.06.1991 – VIII ZR 149/90, NJW 1991, 2633 unter – II 2 a mwN[↩]
- vgl. BGH, Urteile vom 03.07.1985 – VIII ZR 152/84, NJW-RR 1986, 52 unter – III 1 d; vom 13.03.1996 – VIII ZR 333/94, BGHZ 132, 175, 179; vom 10.01.2006 – X ZR 58/03, NJW-RR 2006, 851 Rn.20; Achilles in Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, HGB, 4. Aufl., § 377 Rn. 145; BeckOK-HGB/Schwartze, Stand: 15.04.2022, § 377 Rn. 50[↩]
- vgl. BGH, Urteile vom 30.01.1985 – VIII ZR 238/83, aaO; vom 25.06.2002 – X ZR 150/00 25[↩]
- vgl. hierzu Achilles in Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, HGB, 4. Aufl., § 377 Rn. 152 aE und 154 ff.; BeckOK-HGB/Schwartze, Stand: 15.04.2022, § 377 Rn. 49; jeweils mwN; siehe bereits RGZ 99, 247, 249 f.[↩]
- vgl. nur BGH, Urteile vom 19.06.1991 – VIII ZR 149/90, NJW 1991, 2633 unter – II 1 c aa; vom 25.11.1998 – VIII ZR 259/97, NJW 1999, 1259 unter – III 2 a; vom 09.11.2022 – VIII ZR 272/20, unter – II 2 b dd (5) (a); siehe auch Achilles in Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, HGB, 4. Aufl., § 377 Rn. 240[↩]
- vgl. BGH, Urteile vom 19.06.1991 – VIII ZR 149/90, aaO unter – II 1 c bb; vom 25.11.1998 – VIII ZR 259/97, aaO; vom 09.11.2022 – VIII ZR 272/20, unter – II 2 b dd (5) (b) [jeweils zu § 377 HGB]; vom 26.08.2020 – VIII ZR 351/19, BGHZ 227, 15 Rn. 62[↩]
- st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteile vom 09.07.2014 – VIII ZR 376/13, BGHZ 202, 39 Rn. 42; vom 28.09.2022 – VIII ZR 300/21 14; vom 09.11.2022 – VIII ZR 272/20, unter – II 2 b dd (5) (b); jeweils mwN[↩]
- vgl. BGH, Urteile vom 26.10.2009 – II ZR 222/08, NJW 2010, 64 Rn. 18; vom 09.11.2022 – VIII ZR 272/20, unter – II 2 b dd (5) (d) [↩]
- vgl. zur Bedeutung eines solchen Verhaltens für die Annahme eines Verzichts BGH, Urteile vom 19.06.1991 – VIII ZR 149/90, NJW 1991, 2633 unter – II 1 c aa; vom 25.11.1998 – VIII ZR 259/97, NJW 1999, 1259 unter – III 2 a[↩]
- vgl. BGH, Urteile vom 29.03.1978 – VIII ZR 245/76, NJW 1978, 2394 unter – IV 2 b; vom 19.06.1991 – VIII ZR 149/90, aaO unter – II 1 c bb; vom 25.11.1998 – VIII ZR 259/97, aaO[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 19.06.1991 – VIII ZR 149/90, NJW 1991, 2633 unter – II 1 c cc mwN[↩]
- BGH, Urteil vom 08.11.1979 – III ZR 115/78, NJW 1980, 782 unter II[↩]
Bildnachweis:
- VW Tiguan: Insa Osterhagen | CC0 1.0 Universal