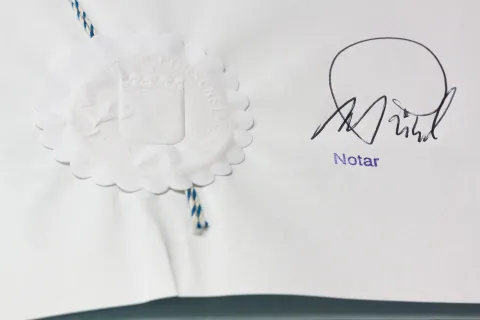Der ein Firmenmissbrauchsverfahren Anregende hat weder ein Beschwerderecht gegen die eine Verfahrenseinleitung ablehnende Entscheidung des Registergerichts noch gegen die Beendigung eines auf seine Anregung hin eingeleiteten Verfahrens.

Eine solche Beschwerde ist zwar gemäß § 58 Abs. 1 FamFG statthaft, wenn das Registergericht nicht bereits die Einleitung eines Verfahrens wegen unbefugten Firmen/Namensgebrauchs abgelehnt, sondern ein solches per Beschluss eröffnet. dann jedoch per Beschluss entschieden hat, das bereits eingeleitete Verfahren nicht weiterzuführen, indem es den als Anregung ausgelegten Antrag auf Einleitung eines Firmenmissbrauchsverfahrens zurückgewiesen hat. Allerdings ist der Anregende nicht beschwerdebefugt.#
Gemäß § 59 Abs. 1 FamFG steht die Beschwerde nur demjenigen zu, der durch den Beschluss in seinen Rechten beeinträchtigt ist. Erforderlich ist ein unmittelbarer, nachteiliger Eingriff in ein dem Beschwerdeführer zustehendes subjektives Recht. Die angefochtene Entscheidung muss ein bestehendes Recht des Beschwerdeführers aufheben, beschränken, mindern, ungünstig beeinflussen oder gefährden, die Ausübung dieses Rechts stören oder dem Beschwerdeführer die mögliche Verbesserung seiner Rechtsstellung vorenthalten oder erschweren. Die tatsächlichen Grundlagen der Rechtsbeeinträchtigung, bei denen es sich um doppelrelevante Tatsachen handelt, die sowohl für die Zulässigkeit als auch für die Begründetheit der Beschwerde entscheidend sind, sind schlüssig vorzutragen1.
Die Anregende hat nicht schlüssig dargelegt, dass sie durch die Entscheidung des Registergerichts, das auf ihre Anregung eingeleitete Firmenmissbrauchsverfahren nicht fortzuführen, in einem eigenen Recht beeinträchtigt ist. Der ein Firmenmissbrauchsverfahren gemäß § 392 Abs. 1, 2 FamFG i.V.m. § 2 Abs. 2 PartGG und § 37 Abs. 1 HGB Anregende hat weder ein Beschwerderecht gegen die eine Verfahrenseinleitung ablehnende Entscheidung des Registergerichts noch gegen die Beendigung eines auf seine Anregung hin eingeleiteten Verfahrens.
Teilweise wird allerdings ein Beschwerderecht des ein Firmenmissbrauchsverfahren Anregenden angenommen2, wofür die Beeinträchtigung des eigenen Firmen- oder Namenrechts ausreichend sein soll. Dagegen verneint eine andere Ansicht ein solches Beschwerderecht3.
Der Bundesgerichtshof schließt sich der zuletzt genannten Ansicht an.
Es besteht bereits kein subjektives Recht für den das Firmenmissbrauchsverfahren Anregenden auf ein Einschreiten des Registergerichts, so dass es für ihn auch kein Beschwerderecht gegen eine das Tätigwerden ablehnende Entscheidung des Registergerichts geben kann, selbst wenn ein Verfahren auf seine Anregung hin zunächst eingeleitet wurde.
Der Bundesgerichtshof hat bereits in seinem Urteil vom 10.11.1969 entschieden, dass der Anwendungsbereich des § 37 Abs. 2 HGB sich nicht nur auf die Verletzung absoluter Rechte beschränke, da anderenfalls ein großer Teil der durch eine unzulässige Firmierung in Mitleidenschaft gezogenen Betroffenen lediglich auf das Einschreiten des Registergerichts – gemeint nach § 37 Abs. 1 HGB i.V.m. § 140 FGG – angewiesen bleibe, das sie zwar anregen könnten, auf das sie aber keinen Anspruch hätten4. Das Verfahren bei unbefugtem Firmen/Namensgebrauch gemäß § 392 Abs. 1, 2 FamFG i.V.m. § 2 Abs. 2 PartGG und § 37 Abs. 1 HGB, in dem das Registergericht von Amts wegen tätig wird, dient nicht dem Schutz von Individualinteressen. § 37 Abs. 1 HGB vermittelt kein subjektives Recht auf Einschreiten des Registergerichts. Das gilt auch für einen gemäß § 37 Abs. 2 HGB in seinen Rechten Verletzten5.
Zweck des § 37 Abs. 1 HGB ist es, den Gebrauch einer dem Verwender nach formellen firmenrechtlichen Grundsätzen nicht zustehenden Firma zu unterbinden. Das vom Registergericht nach § 37 Abs. 1 HGB unter den dort genannten Voraussetzungen einzuleitende Missbrauchsverfahren wird allein zur Wahrung öffentlicher Interessen geführt; die Vorschrift hat ordnungsrechtlichen Charakter6. Mit der Möglichkeit zur Festsetzung eines Ordnungsgeldes wegen der unzulässigen Verwendung einer Firma gemäß § 392 FamFG wird die privatrechtliche Möglichkeit nach § 37 Abs. 2 HGB, aus wettbewerbsrechtlichen Gründen oder wegen des Bestehens von Ausschließlichkeitsrechten Unterlassung zu verlangen, um eine öffentlichrechtliche Sanktionsmöglichkeit durch das Registergericht ergänzt7. Das Verfahren gemäß § 392 FamFG hat keinen unmittelbar drittschützenden Charakter8, weshalb der Verletzte nicht von dem für ihn kostenintensiven Zivilprozess auf das Firmenmissbrauchsverfahren gemäß § 37 Abs. 1 HGB bei dem Registergericht ausweichen kann9. Nur die in § 37 Abs. 2 HGB enthaltene Anspruchsgrundlage hat darüber hinaus zur Verwirklichung desselben Normzwecks drittschützende Funktion10. Die Streitigkeiten, die mit einem Unterlassungsverfahren nach § 37 Abs. 2 HGB zusammenhängen, können somit auch nicht durch ein Beschwerderecht in das Amtsverfahren des Registergerichts, dessen Aufgabenkreis auf der Registerführung liegt, verlagert werden11.
Der einzelne Betroffene ist hierdurch nicht schutzlos gestellt, denn § 37 Abs. 2 HGB gewährt ihm einen eigenen, privatrechtlichen Unterlassungsanspruch. Die Befugnis, bei unberechtigtem Firmen/Namensgebrauch Unterlassung zu verlangen, steht nach § 37 Abs. 2 HGB – hier i.V.m. § 2 Abs. 2 PartGG – jedem zu, der dadurch in seinen Rechten verletzt wird. Dafür reicht es aus, dass der auf Unterlassung Klagende unmittelbar in rechtlichen Interessen wirtschaftlicher Art verletzt ist. Der Anspruch setzt, wie bereits ausgeführt, keine Verletzung eines eigenen Firmenrechts oder sonstigen absoluten Rechts voraus12.
Der Weg, einen das Firmen/Namensrecht Missbrauchenden aus privatem Interesse zur Unterlassung anzuhalten, führt somit, wie das Oberlandesgericht Frankfurt am Main in der Vorinstanz13 zutreffend ausgeführt hat, nicht über § 392 Abs. 1, 2 FamFG i.V.m. § 2 Abs. 2 PartGG und § 37 Abs. 1 HGB und das der Amtsermittlung unterliegende Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit, sondern über einen in einem Zivilprozess mit dessen Parteimaxime und Beibringungsgrundsatz zu erstreitenden Rechtstitel und dessen anschließender Vollstreckung nach dem 8. Buch der Zivilprozessordnung14.
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 5. März 2024 – II ZB 13/23
- BGH, Beschluss vom 20.06.2023 – II ZB 18/22, ZIP 2023, 1744 Rn. 10 mwN[↩]
- Bahrenfuss/Steup, FamFG, 3. Aufl., § 392 Rn. 40; Sternal/Eickelberg, FamFG, 21. Aufl., § 392 Rn. 34; Sternal/Göbel, FamFG, 21. Aufl., § 58 Rn. 65; Sternal/Jokisch, FamFG, 21. Aufl., § 59 Rn. 90; Krafka, Registerrecht, 12. Aufl., Rn. 2460; Müther in Dutta/Jacoby/Schwab, FamFG, 4. Aufl., § 59 Rn. 34[↩]
- RGZ 132, 314, 317 f.; BeckOK FamFG/Ahr, Stand: 1.02.2024, § 392 Rn. 51; Nedden-Boeger in Schulte-Bunert/Weinreich, FamFG, 7. Aufl., § 392 Rn. 71; Reuschle in Ebenroth/Boujong, HGB, 5. Aufl., § 37 Rn. 15[↩]
- BGH, Urteil vom 10.11.1969 – II ZR 273/67, BGHZ 53, 65, 70[↩]
- OLG Hamm, ZIP 1983, 1198, 1202; Heymann/Förster, HGB, 3. Aufl., § 37 Rn. 25; Holzer in Prütting/Helms, FamFG, 6. Aufl., § 392 Rn. 11a; Hopt/Merkt, HGB, 43. Aufl., § 37 Rn. 6; BeckOGK HGB/Maierhofer, Stand: 1.11.2023, § 37 Rn. 54; Ries in Röhricht/Graf von Westphalen/Haas/Mock/Wöstmann, HGB, 6. Aufl., § 37 Rn. 15; Roth/Stelmaszczyk in Koller/Kindler/Drüen, HGB, 10. Aufl., § 37 Rn. 6; Wamser in Henssler/Strohn, 6. Aufl., § 37 HGB Rn. 5[↩]
- BeckOK HGB/Bömeke, Stand: 1.01.2024, § 37 Rn. 1; Ries in Röhricht/Graf von Westphalen/Haas/Mock/Wöstmann, HGB, 6. Aufl., § 37 Rn. 1; Reuschle in Ebenroth/Boujong, HGB, 5. Aufl., § 37 Rn. 1[↩]
- BeckOK FamFG/Ahr, Stand: 1.02.2024, § 392 Rn. 3; Müther in Dutta/Jacoby/Schwab, FamFG, 4. Aufl., § 392 Rn. 2[↩]
- BeckOK FamFG/Ahr, Stand: 1.02.2024, § 392 Rn. 3; Nedden-Boeger in Schulte-Bunert/Weinreich, FamFG, 7. Aufl., § 392 Rn. 71[↩]
- vgl. K. Schmidt, Handelsrecht, 6. Aufl., § 12 – IV Rn. 141[↩]
- BeckOK FamFG/Ahr, Stand: 1.02.2024, § 392 Rn. 3; Hopt/Merkt, HGB, 43. Aufl., § 37 Rn. 1, 9[↩]
- vgl. RGZ 132, 311, 317 f.[↩]
- BGH, Urteil vom 10.11.1969 – II ZR 273/67, BGHZ 53, 65, 70; Urteil vom 08.04.1991 – II ZR 259/90, NJW 1991, 2023; Staub/Burghard, HGB, 6. Aufl., § 37 Rn. 55 mwN[↩]
- OLG Frankfurt a.M., Beschluss vom 18.08.2023 – 20 W 137/22[↩]
- Nedden-Boeger in Schulte-Bunert/Weinreich, FamFG, 7. Aufl., § 392 Rn. 71[↩]