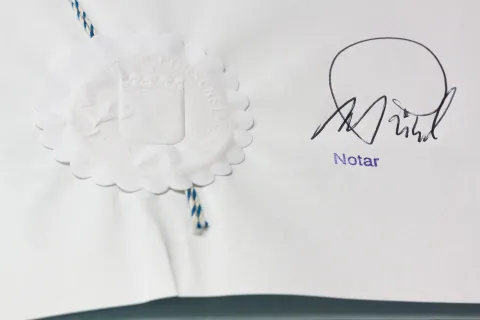Beteiligt sich eine juristische Person des öffentlichen Rechts (hier: ein Landkreis) an einer gewerblich tätigen Personengesellschaft, wird hierdurch ein Betrieb gewerblicher Art begründet. Die im Rahmen der Beteiligung bezogenen Sondervergütungen unterliegen auf der Ebene des Betriebs gewerblicher Art der Körperschaftsteuer und auf der Ebene der Trägerkörperschaft der Kapitalertragsteuer1.

Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehört gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b EStG 2002 n.F. unter weiteren hier nicht streitigen Voraussetzungen auch der nicht den Rücklagen zugeführte Gewinn eines nicht von der Körperschaftsteuer befreiten Betriebs gewerblicher Art i.S. des § 4 KStG 2002 ohne eigene Rechtspersönlichkeit.
Diese Kapitaleinkünfte unterlagen in den Streitjahren gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7c, § 43a Abs. 1 Nr. 6, § 44 Abs. 6 Satz 1 und 4 EStG 2002 n.F. einer 10 %-igen Kapitalertragsteuer, deren Schuldner die juristische Person des öffentlichen Rechts als Trägerkörperschaft des BgA ist. Die Körperschaftsteuer der mit diesen abzugspflichtigen Kapitaleinkünften gemäß § 2 Nr. 2 KStG 2002 i.d.F. des Zweiten Gesetzes zur Änderung steuerlicher Vorschriften -Steueränderungsgesetz 2003-2 -KStG 2002 n.F.- beschränkt steuerpflichtigen Trägerkörperschaft ist durch die Kapitalertragsteuer abgegolten (§ 32 Abs. 1 Nr. 2 KStG 2002).
Betriebe gewerblicher Art sind nach § 4 Abs. 1 Satz 1 KStG 2002 -mit Ausnahme der Hoheitsbetriebe (vgl. § 4 Abs. 5 KStG 2002)- alle Einrichtungen, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft dienen und die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person wirtschaftlich herausheben.
Sondervergütungen, wie die im hier vom Bundesfinanzhof entschiedenen Streitfall bezogenen Avalprovisionen3 gehören zu den gewerblichen Einkünften eines -einzigen- BgA und unterliegen deshalb auf der Ebene des BgA der Körperschaftsteuer und auf der Ebene der Trägerkörperschaft dem abgeltenden Kapitalertragsteuerabzug.
Nach ständiger Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs (RFH) und des Bundesfinanzhofs (BFH) ist die Beteiligung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts an einer gewerblich tätigen Personengesellschaft ein Betrieb gewerblicher Art4. Dies beruht auf der Vorstellung, dass die aus der Beteiligung bezogenen Gewinnanteile Einkünfte des Gesellschafters aus Gewerbebetrieb darstellen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG 2002) und dass die einzelnen Mitunternehmer nach dem System der Besteuerung von Mitunternehmerschaften selbst als Gewerbetreibende und Steuersubjekte behandelt werden. Mit der Erzielung von Einkünften aus Gewerbebetrieb werden somit regelmäßig die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 KStG 2002 erfüllt, begrifflich ist insbesondere auch der Rahmen einer Vermögensverwaltung überschritten5.
Zu den Einnahmen, die die juristische Person aus ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit als Mitunternehmerin einer gewerblich tätigen Personengesellschaft erzielt, gehören nicht nur die Gewinnanteile, sondern auch die Sondervergütungen. Denn die wirtschaftliche Tätigkeit ist eine einheitliche und die gewerblichen Einkünfte des Mitunternehmers im Rahmen der Beteiligung umfassen deshalb beides, sowohl die Gewinnanteile als auch die Sondervergütungen6.
Aus dem BFH-Urteil in BFHE 234, 59, BStBl II 2011, 858, wonach die Beteiligung einer gemeinnützigen Körperschaft an einer gewerblich geprägten Personengesellschaft kein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb i.S. des § 14 der Abgabenordnung ist, kann der Landkreis keine für ihn günstigen Rechtsfolgen ableiten. Die im Streitfall zu würdigende Beteiligung der öffentlichen Hand an einer gewerblich tätigen Personengesellschaft ist mit einer Beteiligung an einer bloß gewerblich geprägten Personengesellschaft nicht vergleichbar. Im letztgenannten Fall übt die Personengesellschaft vermögensverwaltende Tätigkeiten aus, die erst durch eine gesetzliche Fiktion zu gewerblichen Einkünften führen. Demgegenüber geht es im Streitfall um originär gewerbliche Tätigkeiten, die die öffentliche Hand als Mitunternehmer selbst ausübt und aus der sie Gewinnanteile und Sondervergütungen als gewerbliche Einkünfte bezieht.
Nur mit einer solchen Betrachtungsweise kann die Einmalbesteuerung des von der Personengesellschaft erzielten Gewinnes sichergestellt und dem Zweck des § 4 KStG 2002 entsprochen werden7. Die Einmalbesteuerung des Gewinns ist aus Gründen der steuerlichen Gleichbehandlung geboten8.
Bei Privatrechtssubjekten, die sich in vergleichbarer Weise wie der Landkreis unternehmerisch engagieren, unterliegt der Gewinn der Personengesellschaft anteilig bei den Beteiligten der Einkommensteuer oder der Körperschaftsteuer. Hinzu tritt die Gewerbesteuerbelastung auf der Ebene der Personengesellschaft (vgl. § 5 Abs. 1 Satz 3 des Gewerbesteuergesetzes 2002), die den Gesamtgewinn der Mitunternehmerschaft (Gesamthands- und Sonderbereich) erfasst9. Würde die Beteiligung einer juristischen Person des öffentlichen Rechts an der Personengesellschaft nicht als steuerpflichtiger BgA qualifiziert, käme es mangels subjektiver Einkommen- oder Körperschaftsteuerpflicht dieser juristischen Person zu keiner Ertragsbesteuerung, was der unternehmerisch tätigen öffentlichen Hand offenkundig Wettbewerbsvorteile verschaffen würde.
Dieser Gleichbehandlungsgedanke gebietet es aber auch, nicht nur die Besteuerung der Gewinnanteile, sondern auch der Sondervergütungen bei mitunternehmerischer Beteiligung juristischer Personen des öffentlichen Rechts sicherzustellen10. Denn Privatrechtssubjekte müssen die Sondervergütungen als Teil ihrer gewerblichen Einkünfte ebenfalls der Ertragsbesteuerung unterwerfen.
Schließlich ist auch die Nachbelastung der gesamten Einkünfte des BgA auf der Ebene der Trägerkörperschaft geboten. Die ausweislich der Klagebegründung vom Landkreis konzedierte Erfassung der Sondervergütungen beim BgA und der damit einhergehenden Körperschaftsteuerbelastung auf der Ebene der Trägerkörperschaft (erster Belastungsschritt) muss konsequent durchgehalten werden, um das von § 4 KStG 2002 verfolgte Gleichbehandlungsziel zu erreichen. § 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b EStG 2002 n.F. verfolgt den Zweck, durch die Fiktion einer steuerpflichtigen Ausschüttung des von einem BgA ohne eigene Rechtspersönlichkeit erzielten Gewinns an die Trägerkörperschaft die vom Gesetzgeber gewollte steuerliche Gesamtbelastung des -fiktiv ausgeschütteten- Gewinns auf der Ebene des Anteilseigners herzustellen (zweiter Belastungsschritt)11. Ohne eine solche Nachbelastung auf der Ebene der Trägerkörperschaft, die insoweit dem Anteilseigner einer Kapitalgesellschaft entspricht, wäre die öffentliche Hand wiederum gegenüber Privatrechtssubjekten privilegiert. Denn beteiligen sich Kapitalgesellschaften an gewerblich tätigen Personengesellschaften, dann erhöhen die Gewinnanteile und Sondervergütungen den körperschaftsteuerlichen Gewinn und es kommt im Falle der Ausschüttung zur Nachbelastung auf der Ebene des Anteilseigners (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG 2002). Bei der besonderen Konstellation des aus der Beteiligung der öffentlichen Hand an einer gewerblich tätigen Personengesellschaft entstehenden BgA muss der Begriff des Gewinns dieses BgA i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b EStG 2002 n.F. (hierzu BFH, Urteil vom 11.09.2013 – I R 77/11, BFHE 242, 481, BStBl II 2015, 161) im Lichte der vorstehend beschriebenen Zwecksetzung modifizierend verstanden werden; er erfasst auch die Sondervergütungen12.
Es kann dahinstehen, ob Abfallbeseitigung eine hoheitliche Tätigkeit i.S. des § 4 Abs. 5 KStG 2002 darstellt. Denn die Beteiligung an einer gewerblich tätigen Mitunternehmerschaft begründet immer einen BgA, auch wenn deren Gegenstand bei der juristischen Person des öffentlichen Rechts keinen BgA darstellen würde13.
Auch die weiteren von der Revision ins Feld geführten Argumente überzeugen nicht. Dass Privatrechtssubjekte ihre Sonderbetriebsverluste zur Verrechnung mit positiven Einkünften anderer Art nutzen können, zeigt keine Schlechterstellung der öffentlichen Hand auf. Es handelt sich lediglich um die Kehrseite der prinzipiellen Ertragsteuerfreiheit der öffentlichen Hand, die außerhalb ihrer Betriebe gewerblicher Art im Unterschied zu Privaten nichts zu versteuern hat. Die außerdem von der Revision monierte Ungleichbehandlung, dass Avalprovisionen bei einer Beteiligung der öffentlichen Hand an einer Kapitalgesellschaft auf der Ebene der Kapitalgesellschaft als Betriebsausgaben abzugsfähig wären und deswegen im Unterschied zum Streitfall unbesteuert blieben, liegt zwar vor. Diese Ungleichbehandlung ist aber eine typische Folge der fehlenden Rechtsformneutralität des geltenden Steuerrechts, wonach Beteiligungen an Kapitalgesellschaften in vielfacher Weise anders behandelt werden als Beteiligungen an Personengesellschaften14. Daran können nur -verfassungsrechtlich aber grundsätzlich nicht gebotene15- Maßnahmen des Gesetzgebers etwas ändern.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 25. März 2015 – I R 52/13
- Bestätigung von BMF, Schreibens vom 09.01.2015, BStBl I 2015, 111[↩]
- BGBl I 2003, 2645, BStBl I 2003, 710[↩]
- Schmidt/Wacker, EStG, 34. Aufl., § 15 Rz 594[↩]
- RFH, Urteil vom 08.11.1938 – I 347/38, RFHE 45, 155, RStBl 1939, 301; BFH, Urteile vom 06.04.1973 – III R 78/72, BFHE 109, 266, BStBl II 1973, 616; vom 09.05.1984 – I R 25/81, BFHE 141, 252, BStBl II 1984, 726[↩]
- vgl. BFH, Urteile vom 25.05.2011 – I R 60/10, BFHE 234, 59, BStBl II 2011, 858, zum insoweit vergleichbaren Fall des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs; in BFHE 141, 252, BStBl II 1984, 726; Meier/Semelka in Herrmann/Heuer/Raupach, § 4 KStG Rz 24, 28[↩]
- vgl. BFH, Beschluss vom 03.07.1995 – GrS 1/93, BFHE 178, 86, BStBl II 1995, 617; Schmidt/Wacker, a.a.O., § 15 Rz 163, 167[↩]
- Gosch/Heger, KStG, 2. Aufl., § 4 Rz 6 und 50, m.w.N.[↩]
- vgl. RFH, Urteil in RFHE 45, 155, RStBl 1939, 301[↩]
- vgl. z.B. Schmidt/Wacker, a.a.O., § 15 Rz 400 ff.[↩]
- gleicher Auffassung Krämer in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, § 4 KStG Rz 51[↩]
- vgl. BFH, Urteile vom 16.11.2011 – I R 108/09, BFHE 236, 48, BStBl II 2013, 328; vom 23.01.2008 – I R 18/07, BFHE 220, 357, BStBl II 2008, 573; Intemann in Herrmann/Heuer/Raupach, § 20 EStG Rz 340, m.w.N.; Krämer in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, § 4 KStG Rz 240[↩]
- vgl. BMF, Schreiben vom 09.01.2015, BStBl I 2015, 111, Rz 31; Bott, DStZ 2015, 112; Schiffers, DStZ 2015, 144[↩]
- R 6 Abs. 2 Satz 2 und 4 KStH 2004; Musil in Mössner/Seeger, Körperschaftsteuergesetz, § 4 Rz 135; Meier/Semelka in Herrmann/Heuer/Raupach, § 4 KStG Rz 30[↩]
- dazu anschaulich Knobbe-Keuk, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, 9. Aufl., S. 1027 ff.[↩]
- vgl. BVerfG, Beschluss vom 21.06.2006 – 2 BvL 2/99, BVerfGE 116, 164[↩]