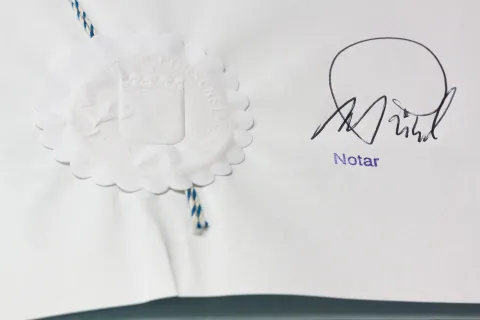Ein Antrag auf Versagung der Restschuldbefreiung kann bei angezeigter Masseunzulänglichkeit bis zur Einstellung des Insolvenzverfahrens gestellt werden, auch wenn eine abschließende Gläubigerversammlung durchgeführt worden ist.

Dies entschied der Bundesgerichtshof in einem Fall, auf den die Vorschriften der Insolvenzordnung in der seit dem 1.07.2014 geltenden Fassung Anwendung finden (vgl. Art. 103h EGInsO), weil das Insolvenzverfahren nach dem 30.06.2014 beantragt worden ist.
Danach kann der Antrag des Gläubigers, dem Schuldner die Restschuldbefreiung zu versagen, bis zum Schlusstermin oder bis zur Entscheidung nach § 211 Abs. 1 InsO schriftlich gestellt werden (§ 290 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 InsO). Vorliegend ist nicht ein Schlusstermin gemäß § 197 InsO durchgeführt, sondern das Insolvenzverfahren wegen Masseunzulänglichkeit durch Beschluss vom 15.01.2020 nach § 211 Abs. 1 InsO eingestellt worden. Die am 19.03.2019 durchgeführte Gläubigerversammlung ist einem Schlusstermin nicht gleichzustellen. Der schriftlich gestellte Antrag der Gläubigerin vom 03.07.2019, dem Schuldner die Restschuldbefreiung zu versagen, erfolgte gemäß § 290 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 InsO ebenso rechtzeitig, wie auch das Insolvenzgericht nach Einstellung des Insolvenzverfahrens noch über den Versagungsantrag entscheiden durfte. Dem Schuldner ist auch zu Recht die Restschuldbefreiung gemäß § 290 Abs. 1 Nr. 5 InsO wegen Verletzung der ihm obliegenden Auskunfts- und Mitwirkungspflichten versagt worden.
Ein Schlusstermin gemäß § 197 InsO ist nicht durchgeführt worden, nachdem eine Schlussverteilung im Sinne von § 196 InsO mit Blick auf die durch den Insolvenzverwalter am 27.10.2015 angezeigte Masseunzulänglichkeit nicht erfolgen konnte. Bei der Einstellung wegen Masseunzulänglichkeit findet kein Schlusstermin statt1.
Die am 19.03.2019 von dem Insolvenzgericht durchgeführte Gläubigerversammlung ist einem Schlusstermin im Sinne von § 197 InsO auch nicht gleichzustellen.
Bei der Zustimmung zur Schlussverteilung bestimmt das Insolvenzgericht den Schlusstermin, der zur Erörterung der Schlussrechnung des Insolvenzverwalters, zu der Erhebung von Einwendungen gegen das Schlussverzeichnis und zu der Entscheidung der Gläubiger über die nicht verwertbaren Gegenstände der Insolvenzmasse dient (vgl. § 197 Abs. 1 InsO). Mit Blick auf die am 27.10.2015 angezeigte Masseunzulänglichkeit konnte vorliegend eine Schlussverteilung im Sinne von § 196 InsO nicht erfolgen.
Das Insolvenzgericht hat einen Termin zur Erörterung der Schlussrechnung des Insolvenzverwalters, Erhebung von Einwendungen gegen das Schlussverzeichnis durch die Insolvenzgläubiger, Entscheidung der Gläubiger über nicht verwertbare Gegenstände der Insolvenzmasse, zu dem Antrag auf Festsetzung der Vergütung des Insolvenzverwalters und zu der Anregung des Insolvenzverwalters, das Verfahren gemäß § 211 InsO einzustellen, sowie zu der Anhörung der Beteiligten zu dem Antrag des Schuldners auf Erteilung der Restschuldbefreiung anberaumt.
Diese am 19.03.2019 durchgeführte Gläubigerversammlung ist einem Schlusstermin nicht gleichzustellen. Zwar handelte es sich auch insoweit um eine abschließende Gläubigerversammlung im Rahmen des Insolvenzverfahrens. Das Insolvenzgericht hat jedoch den Schlusstermin als letzte und verfahrensabschließende Gläubigerversammlung gleichzeitig mit der Zustimmung zur Schlussverteilung gemäß § 196 Abs. 2 InsO von Amts wegen zu bestimmen2. Entgegen vielfältigen Stimmen in der Literatur3 ist eine Gleichstellung einer abschließenden Gläubigerversammlung mit einem Schlusstermin im Sinne von § 197 InsO nicht geboten4.
Ist Masseunzulänglichkeit angezeigt, findet kein Schlusstermin statt. Hat der Schuldner Restschuldbefreiung beantragt, muss die nach § 287 Abs. 4 InsO gebotene Anhörung der Insolvenzgläubiger entweder in einer Gläubigerversammlung oder im schriftlichen Verfahren erfolgen. Trotz dieses Erfordernisses hat der Gesetzgeber den Gläubigern in diesen Fällen die Möglichkeit eröffnet, einen Antrag auf Versagung der Restschuldbefreiung bis zur Einstellung des Verfahrens nach § 211 Abs. 1 InsO zu stellen. Damit korrespondiert die Regelung in § 297a InsO, nach der die Restschuldbefreiung auch versagt werden kann, wenn sich im Falle des § 211 InsO nach der Einstellung des Verfahrens herausstellt, dass ein Versagungsgrund vorgelegen hat und der Gläubiger bis zu diesem Zeitpunkt keine Kenntnis davon hatte. Der Wortlaut dieser Regelungen ist eindeutig. Der danach maßgebliche Zeitpunkt der Einstellung des Verfahrens kann schon aus Gründen der Rechtsklarheit nicht vorverlegt werden. Eine nach Art. 3 Abs. 1 GG nicht gerechtfertigte Schlechterstellung des Schuldners und Besserstellung des Gläubigers liegt darin nicht, denn die unterschiedliche Handhabung ist Folge der unterschiedlichen Verfahren. Daher ist die Regelung des § 290 Abs. 2 Satz 1 InsO – entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde – nicht teleologisch dahingehend zu reduzieren, dass an die Stelle der Entscheidung nach § 211 Abs. 1 InsO der Termin der abschließenden Gläubigerversammlung treten würde.
Der schriftlich gestellte Antrag der Gläubigerin vom 03.07.2019, dem Schuldner die Restschuldbefreiung zu versagen, erfolgte vor der Einstellung des Insolvenzverfahrens gemäß § 211 Abs. 1 InsO durch den Beschluss vom 15.01.2020 und damit nach § 290 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 InsO rechtzeitig. Dem steht der Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 08.03.20185, der zu dem bis zum 1.07.2014 geltenden Recht ergangen ist, nicht entgegen. Denn dort wird ausgeführt, Anträge, die erst nach dem Schlusstermin gestellt wurden, konnten (und können auch heute) nicht berücksichtigt werden. Die Aussage hat weiterhin Gültigkeit, bezieht sich jedoch auf die Zäsurwirkung des Schlusstermins und auch nur auf diese6. Nachdem im Fall der Einstellung des Insolvenzverfahrens gemäß § 211 Abs. 1 InsO gerade kein Schlusstermin durchgeführt wird, ist entsprechend dem Gesetzeswortlaut auf den das Verfahren bei Anzeige der Masseunzulänglichkeit beendenden Beschluss abzustellen.
Das Insolvenzgericht durfte, wie dies in § 290 Abs. 2 Satz 2 InsO in Verbindung mit § 290 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 Fall 2 InsO bestimmt ist, über den Versagungsantrag der Gläubigerin nach dem Beschluss über die Einstellung des Verfahrens wegen Masseunzulänglichkeit entscheiden. Angesichts des eindeutigen Wortlauts der Vorschrift findet die Auffassung, die in § 289 Abs. 2 Satz 2 InsO in der bis zum 30.06.2014 geltenden Fassung vorgeschriebene Reihenfolge sei beizubehalten und es müsse über einen Versagungsantrag vor Beendigung des Insolvenzverfahrens entschieden werden7, im Gesetz keine Stütze. Offenbleiben kann an dieser Stelle, ob das Gericht nur zu den in § 290 Abs. 2 Satz 2 InsO genannten Zeitpunkten oder auch schon vorher über einen Versagungsantrag entscheiden darf8.
Der Umstand, dass die nun geregelte Reihenfolge der Verfahrensschritte zu Schwierigkeiten führen kann9, rechtfertigt nicht, die gesetzgeberische Entscheidung außer Acht zu lassen, den Gläubigern die Möglichkeit zu eröffnen, bis zu dem Schlusstermin oder der Einstellung des Verfahrens wegen Masseunzulänglichkeit einen Versagungsantrag zu stellen. Jedenfalls danach darf dann über die Versagung der Restschuldbefreiung entschieden werden. Auch dadurch wird das Anliegen des Gesetzgebers umgesetzt, die Gläubigerrechte zu stärken10.
Die angefochtene Entscheidung ist schließlich nicht zu beanstanden, soweit die Voraussetzungen einer Versagung der Restschuldbefreiung gemäß § 290 Abs. 1 Nr. 5 InsO wegen Verletzung der Auskunfts- und Mitwirkungspflichten bejaht worden sind.
Dem Schuldner ist die Restschuldbefreiung durch Beschluss zu versagen, wenn dies von einem Insolvenzgläubiger, der seine Forderung angemeldet hat, beantragt worden ist und wenn der Schuldner Auskunfts- oder Mitwirkungspflichten nach der Insolvenzordnung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat (§ 290 Abs. 1 Nr. 5 InsO).
Mit Schriftsatz vom 03.07.2019 beantragte die Gläubigerin die Versagung der Restschuldbefreiung, weil der Schuldner unwahre Angaben über sein Vermögen gemacht und seine Auskunftspflicht verletzt habe. Die Gläubigerin hat vor der Einstellung des Insolvenzverfahrens gemäß § 211 Abs. 1 InsO die Kenntnis von dem Versagungsgrund erlangt und den Versagungsantrag gestellt; entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde liegt ein Fall des § 297a InsO nicht vor.
Die Antragstellerin ist Insolvenzgläubigerin des Schuldners; die von ihr angemeldete Forderung wurde zur Tabelle festgestellt.
Der gesetzlich geforderte Gläubigerantrag ist nur zulässig, wenn der Versagungsgrund glaubhaft gemacht wird (§ 290 Abs. 2 InsO). Die Vorschrift des § 290 Abs. 2 InsO soll verhindern, dass das Insolvenzgericht auf bloße Vermutungen gestützte aufwendige Ermittlungen führen muss. Das spricht dafür, dass es in die sachliche Prüfung des Antrags nur eintreten soll, wenn nach dem Vortrag des Gläubigers die Voraussetzungen eines der in § 290 Abs. 1 InsO aufgezählten Versagungstatbestände wahrscheinlich gegeben sind11. Die Glaubhaftmachung des Versagungsgrundes kann dabei auch durch ausreichende Bezugnahme auf schriftlichen Erklärungen eines Insolvenzverwalters erfolgen12. Sie ist ausnahmsweise nicht erforderlich, wenn die Tatsachen, auf die der Antragsteller seinen Antrag stützt, unstreitig sind13.
Nach diesen Maßstäben war der Versagungsantrag zulässig. Sowohl in dem Bericht vom 17.02.2016 als auch in dem Bericht vom 16.02.2017 hat der Insolvenzverwalter dem Insolvenzgericht mitgeteilt, dass der Schuldner jeweils auf ausdrückliche Nachfrage erklärt habe, über kein Einkommen zu verfügen. Mit Schriftsatz vom 18.07.2017 hat die Gläubigerin demgegenüber geäußert, der Schuldner sei voll berufstätig und arbeite nach wie vor ganztags. Mit Schreiben vom 04.10.2017 hat der Schuldner erklärt, er erhalte ein monatliches Einkommen in Höhe von 1.406, 45 €.
Der Schuldner hat seine Auskunfts- und Mitwirkungspflichten nach der Insolvenzordnung grob fahrlässig verletzt, denn er hat nach den Feststellungen des Insolvenzverwalters in seinem Schlussbericht vom 14.11.2018 auf die ausdrückliche Frage des Insolvenzverwalters Anfang 2017 mitgeteilt, über kein Einkommen zu verfügen. Ermittlungen des Insolvenzverwalters haben jedoch ergeben, dass der Schuldner tatsächlich bereits seit April 2016 in einem Anstellungsverhältnis gewesen war und Teile seines dadurch erzielten Einkommens pfändbar waren. Eine „Heilung“ des Verstoßes gegen § 290 Abs. 1 Nr. 5 InsO ist durch das Angebot des Schuldners, 4.000 € zur Masse zu zahlen, nicht eingetreten, da eine solche voraussetzt, dass der Schuldner von sich aus eine gebotene, aber zunächst unterlassene Auskunftserteilung nachholt, bevor sein Verhalten aufgedeckt und ein Versagungsantrag gestellt worden ist14. Der Schuldner hat auch grob fahrlässig gehandelt, denn das Auskunftsverlangen war durch die gezielte Nachfrage des Insolvenzverwalters in einer Weise konkretisiert worden, die bei dem Schuldner keine Unklarheit über die von ihm zu erteilenden Angaben aufkommen lassen konnte15. Die durch die Rechtsbeschwerde insoweit erhobenen Verfahrensrügen hat der Bundesgerichtshof geprüft, aber nicht für durchgreifend erachtet. Von einer weiteren Begründung wird gemäß § 564 ZPO in Verbindung mit § 577 Abs. 6 Satz 2 ZPO abgesehen.
Die Verletzung der Auskunfts- und Mitwirkungspflichten des Schuldners war ihrer Art nach zudem geeignet, die Befriedigung der Insolvenzgläubiger zu gefährden. Die Offenlegung der Einkünfte des Schuldners, die gegebenenfalls Bestandteil der Masse werden (§ 35 Abs. 1 InsO), berührt grundsätzlich die Befriedigungsaussichten der Gläubiger16.
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 24. März 2022 – IX ZB 35/21
- BGH, Beschluss vom 19.03.2009 – IX ZB 134/08, ZVI 2009, 348 Rn. 3[↩]
- vgl. Uhlenbruck/Wegener, InsO, 15. Aufl., § 197 Rn. 2[↩]
- vgl. MünchKomm-InsO/Stephan, 4. Aufl., § 289 Rn.19; FK-InsO/Ahrens, 9. Aufl., § 289 Rn. 18; BeckOK-InsR/Riedel, Stand: 15.01.2022, § 290 Rn.09.3; Jaeger/Preuß, InsO, 2020, § 290 Rn. 33; HmbKomm-InsO/Streck, 9. Aufl., § 289 Rn. 3; Ahrens, Das neue Privatinsolvenzrecht, 2. Aufl., Rn. 870a f; Ahrens in Kohte/Ahrens/Grote/Busch/Lackmann, Verfahrenskostenstundung, Restschuldbefreiung und Verbraucherinsolvenzverfahren, 8. Aufl., § 290 InsO Rn. 235[↩]
- vgl. Uhlenbruck/Sternal, InsO, 15. Aufl., § 290 Rn. 13; Graf-Schlicker/Kexel, InsO, 6. Aufl., § 289 Rn. 2; HK-InsO/Waltenberger, 10. Aufl., § 289 Rn. 7[↩]
- BGH, Beschluss vom 08.03.2018 – IX ZB 12/16, WM 2018, 682 Rn. 12[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 08.03.2018, aaO[↩]
- vgl. FK-InsO/Ahrens, 9. Aufl., § 290 Rn. 273[↩]
- vgl. zu dieser Frage Jaeger/Preuß, InsO, 1. Aufl., § 290 Rn. 152 ff; FK-InsO/Ahrens, 9. Aufl., § 290 Rn. 270 ff[↩]
- vgl. FK-InsO/Ahrens, aaO[↩]
- vgl. BT-Drs. 17/11268, S. 15, 27[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 11.09.2003 – IX ZB 37/03, NZI 2003, 662 mwN[↩]
- BGH, Beschluss vom 27.04.2017 – IX ZB 80/16, NZI 2017, 674 Rn. 7[↩]
- BGH, Beschluss vom 15.07.2021 – IX ZB 33/20, NZI 2021, 1028 Rn. 15[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 16.12.2010 – IX ZB 63/09, ZInsO 2011, 197 Rn. 6 mwN[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 19.03.2009 – IX ZB 212/08, ZInsO 2009, 786 Rn. 9 mwN[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 08.01.2009 – IX ZB 73/08, ZInsO 2009, 395 Rn.20[↩]