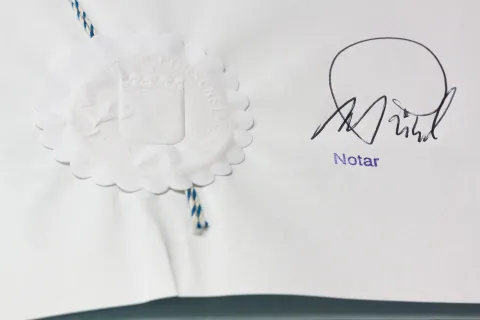Der Bundesgerichtshof hat dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften Fragen zur Auslegung der Handelsvertreter-Richtlinie gemäß Art. 234 EG zur Vorabentscheidung vorgelegt. Diese Auslegungsfragen ergaben sich im Rahmen eines Rechtsstreits um den Ausgleichsanspruch eines fristgerecht gekündigten Vertragshändlers, gegen den sich während der Kündigungsfrist Gründe für eine fristlose Kündigung ergeben haben.

Ist Art. 18 Buchst. a der Richtlinie 86/653/EWG des Rates vom 18. Dezember 1986 zur Koordinierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend die selbständigen Handelsvertreter dahingehend auszulegen, dass er einer nationalen Regelung entgegensteht, nach der der Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters auch im Falle einer ordentlichen Kündigung durch den Unternehmer nicht besteht, wenn ein wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung des Vertrages wegen schuldhaften Verhaltens des Handelsvertreters im Zeitpunkt der ordentlichen Kündigung zwar vorlag, dieser aber für die Kündigung nicht ursächlich war?
Falls eine solche nationale Regelung mit der Richtlinie vereinbar ist:
Steht Art. 18 Buchst. a der Richtlinie einer entsprechenden Anwendung der nationalen Regelung über den Ausschluss des Ausgleichsanspruchs auf den Fall entgegen, dass ein wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung des Vertrages wegen schuldhaften Verhaltens des Handelsvertreters erst nach Ausspruch der ordentlichen Kündigung eintrat und dem Unternehmer erst nach Vertragsbeendigung bekannt wurde, so dass er eine weitere, auf das schuldhafte Verhalten des Handelsvertreters gestützte fristlose Kündigung des Vertrages nicht mehr aussprechen konnte?
Die Entscheidung über den Ausgleichsanspruch des Vertragshändlers hängt von der Beantwortung der Frage ab, ob der in § 89b Abs. 3 Nr. 2 HGB geregelte, auf Vertragshändler entsprechend anzuwendende Ausschlusstatbestand nur dann eingreift, wenn ein schuldhaftes Verhalten des Handelsvertreters oder Vertragshändlers, das eine fristlose Beendigung des Vertrages rechtfertigt, für die Kündigung des Unternehmers ursächlich geworden ist, oder ob der Ausschlusstatbestand auch dann (entsprechende) Anwendung findet, wenn im Falle einer ordentlichen Kündigung durch den Unternehmer ein wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung erst nach Ausspruch der ordentlichen Kündigung eingetreten ist, dem Unternehmer aber erst nach Vertragsbeendigung bekannt wurde, so dass er eine weitere, auf das schuldhafte Verhalten des Handelsvertreters oder Vertragshändlers gestützte Kündigung des Vertrages nicht mehr aussprechen konnte. Dies hängt von der Auslegung von Art. 18 Buchst. a der Richtlinie 86/653/EWG des Rates vom 18. Dezember 1986 zur Koordinierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend die selbständigen Handelsvertreter1 ab. Zwar regelt die Richtlinie unmittelbar nur das Recht der Handelsvertreter, nicht das der Vertragshändler. Da aber das Handelsvertreterrecht nach deutschem Recht auf das Rechtsverhältnis der Vertragshändler entsprechend anzuwenden ist, kommt es für die Entscheidung über den Ausgleichsanspruch der Klägerin als Vertragshändlerin darauf an, welche Auswirkungen die Richtlinie auf die Auslegung und Anwendung der handelsvertreterrechtlichen Bestimmung des § 89b Abs. 3 Nr. 2 HGB hat.
Nach dem nationalen deutschen Recht (§ 89b Abs. 1 Satz 1 HGB) kann der Handelsvertreter von dem Unternehmer nach Beendigung des Vertragsverhältnisses unter bestimmten Voraussetzungen einen angemessenen Ausgleich verlangen. § 89b Abs. 3 Nr. 2 HGB bestimmt, dass dieser Anspruch nicht besteht, wenn der Unternehmer das Vertragsverhältnis gekündigt hat und für die Kündigung ein wichtiger Grund wegen schuldhaften Verhaltens des Handelsvertreters vorlag. Der Wortlaut der Vorschrift verlangt nicht, dass der Unternehmer das Vertragsverhältnis mit dem Handelsvertreter wegen eines schuldhaften Verhaltens des Handelsvertreters fristlos gekündigt hat. Ein wichtiger Grund, der eine fristlose Kündigung gerechtfertigt hätte, muss im Zeitpunkt der Kündigung lediglich objektiv vorgelegen haben. Dementsprechend hat der Bundesgerichtshof im Jahr 1963 zu § 89b Abs. 3 Satz 2 HGB (aF), der wortgleichen Vorgängerbestimmung zu § 89b Abs. 3 Nr. 2 HGB, entschieden, durch die Formulierung sei klargestellt, dass der wichtige Grund bei der Kündigung nicht angegeben werden müsse. Darüber hinaus sei auch nicht erforderlich, dass der wichtige Grund für die Kündigung des Unternehmers ursächlich gewesen sei. Für die Kündigung des Unternehmers genüge es, dass der Kündigungsgrund im Zeitpunkt der Kündigung objektiv vorgelegen habe; es sei nicht erforderlich, dass der Unternehmer sich schon bei der Kündigung auf ihn berufen habe oder dass er ihm überhaupt bekannt gewesen sei2.
In einem weiteren Urteil aus dem Jahr 1967 hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass Sinn und Zweck des § 89b Abs. 3 Satz 2 HGB (aF) eine entsprechende Anwendung der Vorschrift in Fällen erforderten, in denen der Unternehmer fristgerecht gekündigt und der Handelsvertreter danach, jedoch vor Vertragsende, sich eines Verhaltens schuldig gemacht habe, das eine fristlose Kündigung durch den Unternehmer gerechtfertigt hätte, von dem dieser aber erst nach Vertragsende erfahren habe. In der genannten Vorschrift komme der Wille des Gesetzes zum Ausdruck, dass der Ausgleichsanspruch bei einer Kündigung durch den Unternehmer entfalle, wenn gegen den Handelsvertreter ein wichtiger Kündigungsgrund aus schuldhaftem Verhalten vorgelegen habe. Es sei nicht einzusehen, warum in solchen Fällen der Unternehmer schlechter und der Handelsvertreter besser gestellt sein sollte, in denen das schuldhafte Verhalten des Handelsvertreters erst in den Zeitraum nach Ausspruch einer fristgerechten Kündigung durch den Unternehmer, aber vor Ablauf der Kündigungsfrist falle. Denn auch wenn der Vertrag gekündigt sei, blieben die Parteien bis zu seiner Beendigung an ihn gebunden. Erfahre der Unternehmer vor Vertragsende von dem nachträglich entstandenen wichtigen Kündigungsgrund, habe er noch Gelegenheit, diesen Grund zum Anlass einer neuen Kündigung zu nehmen. Erfahre er davon erst nach der infolge der fristgerechten Kündigung eingetretenen Vertragsbeendigung, bestehe für ihn keine Kündigungsmöglichkeit mehr. Mindestens in einem solchen Fall sei die entsprechende Anwendung von § 89b Abs. 3 Satz 2 HGB (aF) geboten3.
Es ist fraglich, ob der Wortlaut des § 89b Abs. 3 Nr. 2 HGB und eine Auslegung und analoge Anwendung dieser Bestimmung entsprechend der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu der wortgleichen Vorgängerbestimmung in § 89b Abs. 3 Satz 2 HGB (aF) mit Art. 18 Buchst. a der Richtlinie vereinbar sind. Nach Art. 18 Buchst. a der Richtlinie besteht der Anspruch auf Ausgleich nach Art. 17 der Richtlinie nur dann nicht, wenn der Unternehmer den Vertrag „wegen“4 eines schuldhaften Verhaltens des Handelsvertreters beendet hat, das aufgrund der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften eine fristlose Beendigung des Vertrages rechtfertigt. Der Wortlaut der Richtlinie fasst die Voraussetzungen für einen Ausschluss des Ausgleichsanspruchs damit enger als § 89b Abs. 3 Nr. 2 HGB. Dies wirft die Frage der Vereinbarkeit von § 89b Abs. 3 Nr. 2 HGB mit Art. 18 Buchst. a der Richtlinie auf und, sofern diese zu bejahen sein sollte, die weitere Frage, ob an der bisherigen Rechtsprechung zur entsprechenden Anwendung des § 89b Abs. 3 Nr. 2 HGB im Hinblick auf Art. 18 Buchst. a der Richtlinie festgehalten werden kann.
Der deutsche Gesetzgeber hat in der Begründung des Regierungs-entwurfs zum Gesetz zur Durchführung der EG-Richtlinie zur Koordinierung des Rechts der Handelsvertreter vom 23. Oktober 19895 ausgeführt, die Richtlinie lehne sich in ihren Grundzügen weitgehend an die (damaligen) Regelungen des Handelsgesetzbuchs an, so dass sich die erforderlichen Anpassungen des deutschen Rechts in den meisten Punkten auf Details beschränkten6. In der von § 89b Abs. 3 Satz 2 HGB (aF) abweichenden Formulierung in Art. 18 Buchst. a der Richtlinie hat der deutsche Gesetzgeber keinen Unterschied im sachlichen Regelungsgehalt gegenüber dem in Deutschland bereits seit langer Zeit geltenden Recht gesehen. Er ist der Auffassung gewesen, dass sich insoweit an der Rechtslage in Deutschland durch die Richtlinie nichts geändert habe. Dementsprechend wurde die Bestimmung des § 89b Abs. 3 Satz 2 HGB (aF) im Zuge der Umsetzung der Richtlinie – inhaltlich unverändert – als § 89b Abs. 3 Nr. 2 HGB beibehalten7.
Nach einer im deutschen rechtswissenschaftlichen Schrifttum verbreiteten Ansicht ist dagegen der Wortlaut des § 89b Abs. 3 Nr. 2 HGB zu weit gefasst. Insbesondere wird die Auffassung vertreten, dass die bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, nach der die Kündigung des Unternehmers nicht auf dem schuldhaften Verhalten des Handelsvertreters zu beruhen brau-che, Art. 18 Buchst. a der Richtlinie widerspreche. § 89b Abs. 3 Nr. 2 HGB sei nach dem Gebot richtlinienkonformer Auslegung einschränkend dahin auszulegen, dass ein Kausalzusammenhang zwischen dem schuldhaften Verhalten des Handelsvertreters und der Kündigung bestehen müsse; eine analoge Anwendung der Vorschrift, wie sie der Bundesgerichtshof bisher praktiziert habe, sei nicht mehr zulässig. Habe der Unternehmer die Kenntnis von dem schuldhaften Verhalten des Handelsvertreters erst nach Vertragsbeendigung erlangt, so dass er nicht mehr wegen dieses Verhaltens kündigen könne, sei das Verhalten nur noch im Rahmen der Billigkeitsprüfung nach § 89b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HGB zu berücksichtigen8. Dieser Auffassung haben sich inzwischen einige Obergerichte angeschlossen9.
Der BGH hält für klärungsbedürftig, ob der Wortlaut des § 89b Abs. 3 Nr. 2 HGB im Hinblick auf Art. 18 Buchst. a Richtlinie zu weit gefasst ist und ob aus diesem Grund die bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Auslegung und analogen Anwendung des § 89b Abs. 3 Satz 2 HGB (aF) nicht auf die heute geltende, inhaltlich unverändert gebliebene Vorschrift in § 89b Abs. 3 Nr. 2 HGB übertragen werden kann.
Die Vereinbarkeit des § 89b Abs. 3 Nr. 2 HGB und der zu dieser Bestimmung ergangenen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs mit Art. 18 Buchst. a Richtlinie erscheint trotz des engeren Wortlauts der Richtlinie nicht ausgeschlossen. Dafür sprechen nicht nur die in den Gesetzesmaterialien dokumentierte Auffassung des deutschen Gesetzgebers bei der Umsetzung der Richtlinie in das deutsche Handelsvertreterrecht, sondern auch die Vorarbeiten zur Richtlinie selbst.
Die Erwägungsgründe der Richtlinie, die in den Bezugsvermerken der Richtlinie genannten Vorschläge der Kommission10 sowie die Stellungnahmen des Europäischen Parlaments11 und des Wirtschafts- und Sozialausschusses12 enthalten keine Ausführungen, die hinsichtlich des in § 89b Abs. 3 Nr. 2 HGB geregelten Ausschlusstatbestandes der Auffassung des deutschen Gesetzgebers vom Einklang der Richtlinie mit dem damals bereits geltenden deutschen Recht widersprechen. Vielmehr sollte nach der – in den vorgenannten Stellungnahmen nicht beanstandeten – ursprünglichen Formulierung des Ausschlusstatbestands in Art. 31 Buchst. a) der beiden Kommissionsvorschläge ein Ausgleichsanspruch nicht nur dann nicht bestehen, „wenn der Unternehmer den Vertrag nach Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe a) gekündigt hat“, sondern auch dann, wenn er ihn aus diesem Grund „hätte kündigen können“13. Art. 27 Buchst. a) der Kommissionsvorschläge regelte das Recht zur Kündigung wegen – so die Fassung des zweiten Vorschlags – „eines grob vertragswidrigen Verhaltens oder einer groben Vertragsverletzung“. Die Formulierung des Ausschlusstatbestands in Art. 31 Buchst. a der Kommissionsvorschläge entspricht im entscheidenden Punkt der oben dargestellten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum damals bereits geltenden deutschen Recht. Aus der weiteren Entstehungsgeschichte der Richtlinie sind keine Anhaltspunkte dafür zu erkennen, dass mit der endgültigen Formulierung des Ausschlusstatbestands in Art. 18 Buchst. a der Richtlinie ein von Art. 31 Buchst. a der Kommissionsvorschläge abweichender Regelungsgehalt beabsichtigt worden wäre. Es erscheint deshalb als nicht fern liegend, dass der engeren Formulierung in Art. 18 Buchst. a der Richtlinie nicht die Bedeutung zukommt, die das rechtswissenschaftliche Schrifttum in Deutschland der Formulierung des Art. 18 Buchst. a der Richtlinie entnimmt.
Die Erwägungen, die der zitierten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Ausschlusstatbestand des § 89b Abs. 3 Satz 2 HGB (aF) – jetzt: § 89b Abs. 3 Nr. 2 HGB – zugrunde liegen, hält der BGH weiterhin für überzeugend. Wenn der Unternehmer das Vertragsverhältnis (ordentlich) gekündigt, aber erst nach Vertragsbeendigung von einem zur Kündigung aus wichtigem Grund berechtigenden schuldhaften Verhalten des Handelsvertreters Kenntnis erlangt hat, so dass er nicht wegen dieses Verhaltens kündigen konnte, ist der Handelsvertreter ebenso wenig schutzwürdig, wie wenn der Unternehmer von dem Verhalten des Handelsvertreters noch während der Vertragszeit erfahren und daraufhin das Vertragsverhältnis wegen dieses Verhaltens tatsächlich gekündigt hätte. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass gerade nach einer ordentlichen Kündigung durch den Unternehmer eine gewisse Gefahr bestehen kann, dass der Handelsvertreter die bis zum Vertragsende noch verbleibende Zeit nutzt, um sich ungerechtfertigte Vorteile zu verschaffen, und es dabei zu schuldhaften Verhaltensweisen kommt, von denen der Unternehmer bis zur Vertragsbeendigung nichts erfährt, die ihn aber zur Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt hätten, wenn sie ihm früher bekannt geworden wären.
Der BGH verkennt nicht, dass ein schuldhaftes Fehlverhalten des Handelsvertreters, das für die Kündigung nicht ursächlich war, auch nach der im Schrifttum geforderten, engeren Auslegung des § 89b Abs. 3 Nr. 2 HGB nicht bedeutungslos ist, sondern noch im Rahmen der allgemeinen Billigkeitsprüfung nach § 89b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HGB berücksichtigt werden kann. Allerdings ist dessen Berücksichtigung im Rahmen der Billigkeitsprüfung mit dem zwingenden Ausschlusstatbestand des § 89b Abs. 3 Nr. 2 HGB nicht vergleichbar. Die Billigkeitsprüfung kann zwar dazu führen, dass das Gericht einen vollständigen Ausschluss des Ausgleichsanspruchs für gerechtfertigt hält14. Diese Rechtsfolge ist aber nicht zwingend, denn die allgemeine Billigkeitsprüfung eröffnet dem Gericht einen weiten Beurteilungsspielraum. Einen solchen gerichtlichen Beurteilungsspielraum haben der deutsche und der europäische Gesetzgeber für den Fall eines schwerwiegenden schuldhaften Fehlverhaltens des Handelsvertreters nicht gewollt und deshalb den zwingenden Ausschlusstatbestand in § 89b Abs. 3 Nr. 2 HGB und Art. 18 Buchst. a der Richtlinie geschaffen, bei dem es sich um eine gesetzliche und damit für die Rechtsanwendung verbindliche Konkretisierung von Billigkeitserwägungen handelt15. Ausschlaggebend dafür, dass § 89b Abs. 3 Nr. 2 HGB und Art. 18 Buchst. a der Richtlinie den Ausschluss des Ausgleichsanspruchs zwingend anordnen, ist der Umstand, dass sich der Handelsvertreter während des bestehenden Vertragsverhältnisses ein schwerwiegendes Fehlverhalten hat zu Schulden kommen lassen, das eine fristlose Kündigung rechtfertigt. Ob dem Unternehmer dieser Kündigungsgrund rechtzeitig bekannt geworden ist, so dass er das Vertragsverhältnis „wegen“ des Fehlverhaltens des Handelsvertreters fristlos kündigen konnte, hat für die sachliche Rechtfertigung des Ausschlusstatbestands nach Auffassung des BGH nur untergeordnete Bedeutung. Der zwingende Ausschluss des Ausgleichstatbestands kann nicht davon abhängen, ob es dem Handelsvertreter gelingt, sein Fehlverhalten bis zur Ver-tragsbeendigung zu verheimlichen. Denn der Handelsvertreter, dem dies gelingt, ist ebenso wenig schutzwürdig wie der Handelsvertreter, dessen Fehlverhalten rechtzeitig aufgedeckt wird.
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 29. April 2009 – VIII ZR 226/07
- ABl. EG Nr. L 382, S. 17[↩]
- BGHZ 40, 13, 15 f.[↩]
- BGHZ 48, 222, 224 ff.[↩]
- englisch: „because of“; französisch: „pour“[↩]
- BGBl. I S. 1910[↩]
- BT-Drs. 11/3077, S. 6[↩]
- BT-Drs. 11/3077, S. 9, und BT-Drs. 11/4559, S. 9 f.[↩]
- Canaris, Handelsrecht, 24. Aufl., § 15 Rdnr. 119; Thume in: Küstner/Thume, Handbuch des gesamten Außendienstrechts, Band 2, 8. Aufl., Kap. XI Rdnr. 159; ders. in: Röhricht/Graf von Westphalen, HGB, 3. Aufl., § 89b Rdnr. 140; MünchKommHGB/von Hoyningen-Huene, 2. Aufl., § 89b Rdnr. 173; Löwisch in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, HGB, 2. Aufl., § 89b Rdnr. 63; Hopt, Handelsvertreterrecht, 3. Aufl., § 89b Rdnr. 66; ders. in: Baumbach/Hopt, HGB, 33. Aufl., § 89b Rdnr. 66; Roth in: Koller/Roth/Morck, HGB, 6. Aufl., § 89b Rdnr. 17; Fischer, ZVglRWiss 2002, 143, 156 f.[↩]
- OLG Koblenz, NJW-RR 2007, 1044 f[↩]
- ABl. EG Nr. C 13 vom 18. Januar 1977, S. 2 und ABl. EG Nr. C 56 vom 2. März 1979, S. 5[↩]
- ABl. EG Nr. C 239 vom 9. Ok-tober 1978, S. 17[↩]
- ABl. EG Nr. C 59 vom 8. März 1978, S. 31[↩]
- englisch: „could have terminated“; französisch: „aurait pu mettre fin“[↩]
- vgl. Münch-KommHGB/von Hoyningen-Huene, aaO, § 89b Rdnr. 98 f. m.w.N.[↩]
- vgl. BGHZ 171, 192, 199 m.w.N.[↩]
Bildnachweis:
- AG/LG Düsseldorf: Michael Gaida